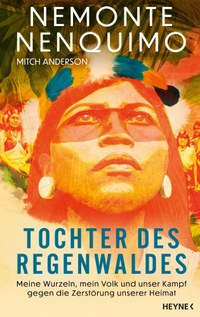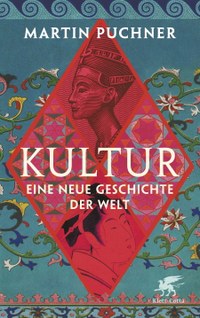Kapitel 1
An jenem Morgen war ich es, die das ferne Dröhnen des Flugzeugs als Erste hörte. Es klang wie das Summen einer Holzbiene unter den Deckenbalken.
Ich saß mit meinem kleinen Bruder Víctor am Feuer und griff in einen warmen Topf mit gekochter Petomo-Frucht. Víctor redete auf unsere zahme Nachtäffin ein, der er Heuschreckengedärme in den Mund schob. Amonka hatte große, vorstehende gelbe Augen, wie zwei Sonnen.
»Víctor! Ist das ein Flugzeug oder eine Biene?«
Ich deutete mit dem Finger nach oben und legte den Kopf schief, wie es unser Vater tat, wenn er bei der Jagd im Wald auf Bewegungen in den Baumkronen lauschte.
Für einen Augenblick war das Geräusch verschwunden. Ich hielt die ölige Petomo-Frucht meinen kleinen Tangarenvögeln hin, die sie mir von den Fingern pickten.
»Víctor, ich habe dir doch schon gesagt, dass du Amonka die Heuschrecke in die Pfoten geben sollst, damit sie sie selbst essen kann. Hör auf, sie ihr mit Gewalt in den Mund zu schieben.«
Obwohl ich erst sechs Jahre alt war, schrieb ich Víctor ständig vor, was er zu tun hatte. Außerdem mochte ich es, wenn unsere zahme Äffin die Insekten mit ihren winzigen Fingern zerteilte. Amonka musste lernen, wie das ging, damit sie später ihren Nachwuchs füttern konnte.
Dann erklang das brummende Geräusch erneut über den Bergen. Dieses Mal war ich mir sicher, dass es keine Holzbiene sein konnte. Es war ein Flugzeug, ein ebo, das Weiße in unser Dorf brachte.
»Ebo, ebo, ebo!«, rief ich laut, damit all meine Brüder wussten, dass ich das Flugzeug oben am Himmel, wo die Weißen wohnten, zuerst bemerkt hatte.
Hastig setzte ich meine Vögel zurück in den Hängekorb in der Ecke des Langhauses. In meinem Kopf erklang die Stimme meiner Mutter. Früh am Morgen, kurz bevor sie sich mit meinem Vater zusammen auf den Weg Richtung Garten gemacht hatte, hatte sie mich zu sich gerufen, einen großen geflochtenen Korb auf dem Rücken und meine kleine Schwester Loida in einem Tuch vor der Brust.
»Nemonte, pass gut auf deinen Bruder auf. Rennt nicht im Dorf herum.«
Ich wusste, dass ich eigentlich zu Hause bleiben müsste. Aber ich überlegte, dass wir einfach zurückkommen würden, sobald das Flugzeug gelandet war.
»Komm, Víctor, wir gucken uns die cowori an!«
Cowori war unser Wort für Außenseiter wie weiße Menschen, denn wenn bei uns ein Flugzeug landete, konnte man sicher sein, dass cowori ausstiegen.
Draußen hinter dem Haus machten sich meine beiden älteren Brüder Ñamé und Opi ein Vergnügen daraus, mit Blasrohren auf die Kolibris zu schießen, die zwischen den Guavenblüten umherschwirrten. Doch kurz darauf überholten sie uns auf dem Pfad zur Landebahn. Dabei riefen sie zu meinem Unmut »Ebo, ebo, ebo!«, als hätten sie das Flugzeug zuerst gehört.
Barfuß liefen wir am Haus von Tante Wiamenke und Onkel Nenecawa vorbei.
»Nemonte!«, rief mein Onkel aus seinem Rollstuhl. »Kommt dem ebo lieber nicht zu nahe! Sonst verschluckt es euch und hackt euch in kleine Stücke!«
Als wir die Landebahn erreicht hatten, kletterten wir auf den Sternapfelbaum, eines unserer vielen Verstecke. Das Flugzeug war immer noch weit entfernt, nicht mehr als ein Punkt über den bewaldeten Bergkämmen. Die Sternäpfel waren noch nicht ganz reif, aber wir probierten sie trotzdem und spielten eines unserer Lieblingsspiele: Wir taten so, als klebten unsere Lippen zusammen.
»Die Weißen leben im Himmel«, murmelte ich in Víctors Richtung, die geschürzten Lippen fast taub von den klebrigen Früchten.
»Echt?«
»Warum sollten sie sonst so weiß sein?«
»Von den Wolken?«
»Nein, von der Sonne«, sagte ich und vergaß, den Mund geschlossen zu halten. »Vom Licht der Sonne. Willst du wissen, warum sie so groß sind?«
»Warum?«
»Weil es dort oben keinen Wald gibt. Sie müssen sich nicht unter den Ästen ducken. Sie können einfach immer weiterwachsen.«
Während das Flugzeug über uns kreiste, ließ ich den Blick über unser Dorf – Toñampare – schweifen. Ich sah das sattgrüne Sumpfgras, das rund um die Lagune wuchs, wo die riesige Anakonda hauste. Den Pfad, der zum Garten meiner Mutter führte. Dahinter den Sumpf, wo sich Horden von Pekaris an den Früchten der BuritiPalmen labten. Ich konnte über den Fluss zum steilen Hang hinüberschauen, wo Mengatowe, der Jaguarschamane, lebte. Zum Bach, wo wir unsere Kleidung wuschen. Und zur Ansiedlung der BaihuaFamilie dahinter, wo der alte Anführer der Krieger, Awa, regelmäßig in seiner Hängematte von Visionen heimgesucht wurde. Meine Mutter hatte uns vor Awa gewarnt. Er sei ein gefährlicher Hexer.
In unserem Dorf wohnten dreißig, vielleicht vierzig Familien, und jede von ihnen hatte ihr eigenes Langhaus, das oko. Die palmengedeckten Dächer reichten bis zum Boden, und im Inneren brannte fast immer ein Feuer. Die okos lauschten abends unseren Geschichten, und ihre Blätterwände flatterten wie Schmetterlinge, wenn wir lachten; bebten, wenn wir krank waren; peitschten, wenn wir wütend waren; und beschützten uns vor dem prasselnden Regen und den tosenden Winden.
Neben dem oko befand sich für gewöhnlich eine kleine Schlafhütte auf Stelzen. Auf dieser Seite des Flusses standen die meisten okos und Schlafhütten im Wald, doch einige wenige säumten die Ufer der Bäche oder schmiegten sich zwischen die Obstbäume neben der grasbewachsenen Landebahn. Wir sahen Rauch daraus aufsteigen.
Am Ende der Piste stand das Haus Gottes, und daneben das Haus von Rachel Saint, der Missionarin und einzigen weißen Frau, die unter uns lebte. Es war aus Holzbrettern und Metallplatten gebaut, die in der Sonne ächzten und im Regen dröhnten. Es verfügte über eine Tür und Gitter vor den Fenstern. In Rachels Haus konnte man nicht einfach einund ausgehen oder einen Arm durch das Fenster strecken.
»Víctor«, rief ich. »Das ebo kommt!«
Amonka kreischte über den plötzlichen Windstoß, als das Flugzeug im Sinkflug über dem Kamm erschien. Seine Räder streiften die Baumwipfel. Im Wald gibt es nichts, was mit dem unnatürlichen Lärm eines Flugzeugs zu vergleichen wäre – weder Blitz und Donner noch das tiefe Grollen der Schwarzen Kaimane, das Heulen des Jaguars, das wilde Spektakel der Wespen oder das Platschen der Anakondas, wenn sie aus dem Wasser hervorschießen.
Das Flugzeug setzte auf und kam auf der Piste zum Stehen. Stille. »Ebo ist eingeschlafen«, erklärte ich Víctor.
Dann öffneten sich die quietschenden Türen und die Weißen stiegen aus.
Sie trugen Schlapphüte, langärmlige Hemden und Gummistiefel.
Auf ihre Nasen und Ohren hatten sie sich weiße Creme geschmiert. Rachel Saint hatte einen sprechenden Kasten neben ihrem Haus. Er hing an einem Baumstamm und war mit Drahtgeflecht umgeben. Darüber sprach sie mit den cowori, die im Himmel lebten, und lud sie zu uns nach unten ein.
Einmal war ich den Weißen nahe genug gekommen, um sie zu riechen, und eine meiner Freundinnen hatte einen von ihnen am Bein angefasst – sie sagte, es habe sich haarig und weich angefühlt. Wir alle glaubten, dass Weiße niemals urinierten. Keiner von uns hatte Rachel Saint jemals pinkeln sehen.
Ich wusste, dass ich Víctor nach Hause bringen sollte. Aber ich tat es nicht. Die cowori gingen fast immer vom Flugzeug zu einem Stück Strand auf der anderen Seite des Flusses. Ich wollte ihnen folgen, um herauszufinden, was sie dort trieben. Und vielleicht hoffte ich auch darauf, etwas geschenkt zu bekommen.
Die cowori brachten immer Geschenke mit. Rachel Saint nannte sie »Geschenke Gottes« oder »Geschenke für die Gläubigen«. Es waren wundervolle Dinge: Süßigkeiten, die süßer waren als die Früchte des Waldes, Puppen mit blauen Augen und blonden Haaren, Bälle, die vom Boden zurücksprangen, Spielzeuge, die rollten. Doch am meisten wünschte ich mir ein Kleid. Einige der anderen Mädchen hatten Kleider, die ihnen weich bis zu den Knien fielen. Keine Wurzel, keine Blüte und keine Rinde erzeugte Farben, die so bunt leuchteten wie diese Kleider.
Meine Familie besaß nur wenige Kleidungsstücke, weil wir sonntags nicht in das Haus Gottes gingen. Das war der Tag, an dem Rachel mit Gott sprach. Die Waorani-Priester sangen dazu traurige Lieder, die ganz anders waren als die Lieder unserer Ältesten zum Tagesanbruch oder die Gartenlieder unserer Frauen. Außerdem war Sonntag der Tag für Geschenke. Wenn die anderen Mädchen aus dem Haus Gottes gelaufen kamen, bauschten sich ihre neuen Kleider in der Sonne.
Ich hatte nur Unterwäsche. Am besten gefiel mir die rote, die ich auch jetzt trug, als Rachel Saint, geschützt durch einen Sonnenschirm, die anderen Weißen zum Fluss führte. Wir folgten ihnen und beobachteten, wie die cowori im feuchten Sand einsanken und zum Einbaum stolperten.
»Siehst du, Víctor, ich habe dir doch gesagt, dass sie im Himmel leben. Sie wissen nicht einmal, wie man auf der Erde läuft.«
Der Fluss führte wenig Wasser, und da wir die Strömung lesen und die Umrisse der Sandbänke im Morgenlicht ausmachen konnten, brauchten wir kein Kanu, um auf die andere Seite zu kommen. Das Wasser reichte mir bis zur Brust, aber seine Bewegungen waren sanft. Amonka saß mit großen Augen auf Víctors Kopf und klammerte die Finger in sein langes Haar. Ein Schwarm Bocachicos schoss wie ein Schatten pfeilschnell flussaufwärts. Auf dem Sand war ein seltsames Zickzackmuster zu sehen – die Spuren von Flussschildkröten.
Die cowori fassten sich an den Händen und bildeten einen Kreis. Außer ihnen waren auch drei Waorani-Priester dabei – Mincaye, dessen Name Wespe bedeutete, Yowe und Kemo. Diese Männer waren einst unsere Krieger gewesen. Jetzt glaubten sie an Wengongi, den großen Himmelsgeist der Weißen. Rachel hatte sie angewiesen, sich die Haare zu schneiden, und ihnen Hemden und lange Hosen gegeben. Aber sie liefen immer noch barfuß, hatten lang herabhängende Ohrläppchen und ihre Haut glänzte genauso dunkel wie meine.
Warum kamen sie hierher?
Ich kannte die Geschichte, wie die Weißen noch vor meiner Geburt gekommen waren, um mein Volk zu erlösen, und unsere Krieger sie mit Speeren durchbohrten und sie mit dem Gesicht im Wasser am Strand liegen ließen. Damals waren wir unerbittlich und töteten jeden, der sich in unser Gebiet wagte. Einer der Missionare war Rachel Saints Bruder gewesen. Sie war nach seinem Tod zu uns gekommen, um sein Werk fortzuführen, und aus irgendeinem Grund hatten wir sie bei uns aufgenommen – offenbar ließen sich die Missionare nicht einmal durch Mord aufhalten. Rachel hatte uns erklärt, dass wir ihren Bruder nicht hätten umbringen dürfen, als er kam und uns erlösen wollte. Ich fragte mich, was das hieß. Was bedeutete »erlösen«? Wovon sollten wir erlöst werden?
Jetzt vermutete ich, dass die Missionare genau an dieser Stelle getötet worden waren. Vielleicht brachte Rachel die cowori immer hierher, damit sie sahen, wo ihr Bruder gestorben war?
Víctor pinkelte und sah zu, wie der durstige Sand sein Wasser trank. Rachel Saint warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu. Sie rügte uns ständig für unsere nackte Haut, selbst die Ältesten. Gott habe uns Kleidung zum Tragen gegeben. Der Teufel zöge sie uns aus.
»Die cowori pinkeln nicht«, zischte ich Víctor zu. »Wusstest du das nicht?«
Rachel bat Mincaye, zu Gott zu sprechen, und er strahlte vor Stolz, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und fing an. Rätselhafte Worte summten wie ein Bienenstock in seinem Mund. Er sprach in unserer Sprache, und schon bald fielen Yowe und Kemo murmelnd mit ein.
»Gott, unser Herr, wir haben dich damals noch nicht gekannt. Doch du hast uns vergeben. Wir haben unsere Hände ins Blut deines Sohnes getaucht. Wir haben uns in Jesu Blut gewaschen.«
Hmmm. Mit Blut kannte ich mich aus. Ich half meiner Mutter immer dabei, die Tiere zu zerlegen, die mein Vater im Wald jagte. Dabei schob ich meine Hände tief in den Bauch der Pekaris, zog ihre Eingeweide heraus und spürte, wie das warme Blut mit dem Tod abkühlte. Aber unser eigenes Blut war laut Ma heilig. Sie wurde wütend, wenn wir uns die Haut aufschürften oder uns mit Angelhaken in die Finger stachen. Zu bluten war also nicht gut, aber warum sprach Mincaye dann davon, sich mit Jesu Blut zu waschen?
Plötzlich sank einer der cowori-Männer auf die Knie. Sein Gesicht war mit Haaren bedeckt, die ihm bis unter das Kinn hingen.
»Halleluja, halleluja, halleluja!«, rief er mit ausgestreckten Armen Richtung Himmel. Aus seinen leuchtend blauen Augen strömten Tränen, die in seinem Bart verschwanden wie Víctors Pipi im Sand.
Konnte das dieser Jesus sein? Er sah den Bildern, die ich von Jesus gesehen hatte, auf jeden Fall sehr ähnlich.
Ich schaute instinktiv zu Rachel Saint, um eine Erklärung zu erhalten. Sie wohnte bei uns und sprach unsere Sprache. Aber sie war keine von uns, und jetzt war ihr Blick leer und in ihren Augen standen Tränen, während ihre Lippen stumm die gleichen Worte formten: »Halleluja! Halleluja!«
Ich wollte nach Hause. Doch als ich mich zu Víctor umdrehte, war er nicht mehr da. Irgendetwas war mit ihm passiert. Er lag zitternd und schlotternd hinter einem Baumstamm auf dem Boden und krümmte die Finger zu Klauen.
Völlig geschockt kniete ich mich über ihn. Er biss die Kiefer so fest aufeinander, dass seine Zähne knirschten. Sein Blick war beängstigend starr. Als wäre er in seinem eigenen Körper gefangen. Amonka klammerte sich an ihn.
»Víctor, hör auf!«, befahl ich barsch.
In dem Augenblick lösten sich seine Finger. Die Muskeln um seinen Mund entspannten sich, und sein Blick wurde weicher.
Ich griff nach seiner Hand. Sie war kalt und feucht. Aber er richtete sich schon wieder auf. Es ging ihm gut.
Ich schaute zu den Leuten am Strand hinüber und stellte erleichtert fest, dass sie immer noch beteten. Niemand hatte etwas bemerkt. Ansonsten hätten wir für das, was gerade passiert war, sicher Ärger bekommen. Rachel hätte es meinen Eltern erzählt. Und dann würden mir die cowori niemals ein Kleid schenken.
Jetzt machte sich die Gruppe auf den Rückweg. Mincaye und Yowe gingen voran; sie erzählten einander lautstark, wie das Flugzeug der Missionare auf dem Strand gelandet war und wie sie den Männern aufgelauert hatten. Sie sprachen, als wären sie dabei gewesen, als wären es ihre eigenen Erinnerungen.
Da begriff ich es: Sie waren die Männer, die die Missionare mit Speeren getötet hatten! Mincaye und Yowe hatten Rachels Bruder umgebracht! Rachel hatte sie an den Ort des Geschehens zurückgebracht, um ihren cowori-Besuchern zu zeigen, dass sie Krieger in Prediger verwandelt hatte.
Ich erzählte Ma nichts von unserem Ausflug zum Strand und auch nicht, was dort mit Víctor passiert war, für den Fall, dass alles meine Schuld war, weil ich den cowori gefolgt war, obwohl ich hätte zu Hause bleiben sollen.
Ein paar Tage später passierte es erneut. Dieses Mal waren wir mit Ma und meiner Tante Wiamenke zusammen im Garten.
»Nemonte«, rief meine Mutter mit strenger Stimme hinter einigen Kochbananenstauden hervor, »wirf noch etwas mehr vom Termitennest auf das Feuer, damit die Insekten Loida in Ruhe lassen!«
Ich brach einen spröden Klumpen ab und legte ihn auf das Feuer. Dabei kamen ein paar Termiten auf meine Hand gekrochen. Der Rauch war milchig-weiß und verbreitete einen beißenden Geruch. Ich schaukelte meine jüngere Schwester Loida in ihrer Hängematte, die zwischen zwei dünnen Bäumen aufgehängt war.
»Wo ist Víctor?«, rief Ma.
»Er ist mit Opi unterwegs«, sagte ich. »Sie suchen nach reifen Papayas.«
Der Garten lag einen kurzen Fußweg von unserem Haus entfernt. Meine Mutter legte mehr Gärten an als alle anderen Frauen des Dorfes – am Fluss, am Ufer der Lagune, an den Hängen –, weil sie keine Waorani war. Sie hatte anderes Blut. Ihr Vater war ein Schamane der Záparo, und ihre Mutter war eine Kichwa gewesen. Ma sagte immer, dass ihr das Gärtnern im Blut liege.
Die Sonne stand senkrecht über uns, daher schützte ich mich mit einem großen Kochbananenblatt, als ich mich neben die Hängematte setzte und meine kleine Schwester in den Schlaf wiegte. Seit dem Ausflug zum Strand hatte ich es gemieden, mich unter freiem Himmel aufzuhalten. Ich wollte nicht, dass die cowori, die dort oben lebten, mich sahen und allen anderen erzählten, dass ich kein Kleid verdient hätte.
Ich schloss die Augen. Das Knacken der Zweige und Äste, das gleichmäßige Prasseln des kleinen Feuers und das Kratzen der Macheten in der Erde machten mich müde. Doch einen Augenblick später riss mich das seltsame, dumpfe Poltern eines wilden Tieres aus dem Schlaf. Ich sprang auf.
Doch es war Víctor, der zwischen den Maniok-Sträuchern hervortaumelte. Auf dem Pfad angekommen, stürzte er zu Boden. Aus seinem Mund kamen Speichel und Schaum.
»Ma! Ma!«, rief ich. »Víctor ist angegriffen worden!«
Eilige Schritte näherten sich vom anderen Ende des Gartens. »Was ist passiert?«, fuhr meine Mutter mich an.
»Ich weiß es nicht. Er ist hingefallen und hat angefangen zu zucken.«
Sie kniete sich über Víctor und suchte seinen Körper nach Schlangenbissen und Skorpionstichen ab. Dann bettete sie seinen Kopf in ihre Hände. Ihre Wangenknochen glänzten feucht in der Sonne und ihr langes, schwarzes Haar fiel auf sein Gesicht, als sie sich vorbeugte und anfing, zu pusten und zu singen.
Plötzlich geschah etwas Fürchterliches: Víctors Gesicht verzog sich zu einem Grinsen. Einem fremdartigen, leeren Grinsen. Es sah unheimlich aus, und ich schaute weg. Passierte das alles nur, weil wir den cowori zum Strand gefolgt waren?