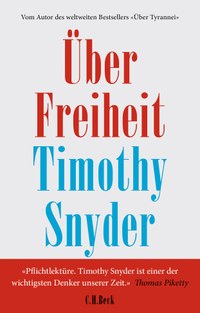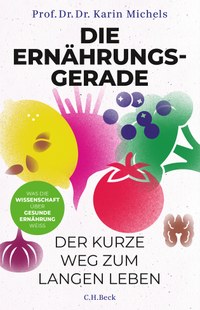Vorwort
«Was denkst du?», fragte Mariia lächelnd in ihrem hellen Kleid, als ich mit eingezogenem Kopf durch die niedrige Tür ihrer ordentlichen kleinen Hütte nach draußen trat, zurück in die Sonne und die Trümmer. «Ist alles so, wie es sein sollte?» Das war es. Ihre Teppiche und Decken waren in schönen geradlinigen Mustern ausgelegt, die mich an futuristische ukrainische Kunst denken ließen. Die Kabel, die zu ihrem Generator führten, waren ordentlich verlegt, und Wasserflaschen standen griffbereit. Ein dickes Buch lag aufgeschlagen auf ihrem Bett.
Außerhalb ihres metallenen Domizils, einer von einer internationalen Organisation zur Verfügung gestellten provisorischen Behausung, hingen Wollpullover zum Trocknen auf einer Leine. Auf einer Bank lag eine hübsche, mit Filz ausgekleidete Holzschublade, wie eine offene Büchse der Pandora. Als ich ihr ein Kompliment dazu machte, bot Mariia mir die Schublade als Geschenk an. Sie war ein Überbleibsel ihres Hauses, das direkt vor uns lag, eine Ruine nach dem Beschuss mit Bomben und Granaten. Nervös blickte sie gen Himmel zu einem vorbeifliegenden Flugzeug. «Alles ist passiert», seufzte sie, «und nichts davon war nötig.»
Wie alle anderen Häuser im Dorf wurde auch das von Mariia während des russischen Angriffs auf die Ukraine zerstört. Posad-Pokrovske, ganz im Süden der Ukraine gelegen, inmitten von Sonnenblumenfeldern in dieser fruchtbaren Gegend, befand sich am Rande des russischen Vormarschs. Ende 2022 hat die ukrainische Armee die Russen so weit zurückgedrängt, dass ihre Artillerie nicht mehr bis hierher reicht, sodass eine sichere Rückkehr oder ein Besuch im Dorf wie meiner jetzt, im September 2023, möglich sind.
Während ich auf der Bank Platz nehme und Mariia zuhöre, denke ich über Freiheit nach. Das Dorf, so könnte man sagen, ist befreit worden. Sind die Menschen hier frei?
VorortOhne Zweifel ist etwas Schreckliches aus dem Leben von Mariia verschwunden: die tägliche Bedrohung durch einen gewaltsamen Tod, eine Besetzung durch Folterer und Mörder. Aber ist das, selbst das, eine Befreiung?
Mariia ist 85 Jahre alt und lebt allein. Jetzt, da sie ihre hübsche kleine Unterkunft hat, ist sie sicherlich freier als zu der Zeit, als sie obdachlos war. Das hat damit zu tun, dass ihre Familie und Freiwillige gekommen sind, um ihr zu helfen. Und weil eine Regierung gehandelt hat, mit der sie sich durch ihre Wählerstimme verbunden fühlt. Mariia beklagt sich nicht über ihr Schicksal. Weinen muss sie nur, wenn sie von den schwierigen Herausforderungen spricht, vor denen ihr Präsident steht.
Das ukrainische Wort «Deokkupation», das wir in unserem Gespräch verwenden, ist präziser als die gängige «Befreiung». Es lädt uns dazu ein, darüber nachzudenken, was wir, über die Beseitigung von Unterdrückung hinaus, für die Freiheit brauchen könnten. Es ist viel Arbeit nötig, um eine ältere Frau in die Lage zu versetzen, Gäste willkommen zu heißen und die normalen Interaktionen eines würdevollen Menschen durchzuführen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Mariia wirklich frei war, ohne ein richtiges Haus mit einem Stuhl und ohne einen freigeräumten Weg zur Straße für ihren Rollator.
Freiheit ist nicht nur die Abwesenheit des Bösen, sondern auch die Anwesenheit des Guten.
—
Die südliche Ukraine ist Steppe; die Nordukraine besteht aus Wald. Als ich eine deokkupierte Stadt im Norden der Ukraine besuchte, hatte ich ähnliche Gedanken. Ich, der ich meine Kinder an einladenden Schulen in New Haven abgesetzt hatte, stand nun vor einem verwaisten Schulgebäude in Jahidne, das die russischen Besatzer in ein kleines Konzentrationslager verwandelt hatten. Fast die ganze Zeit über hatten die Russen dreihundertfünfzig Zivilisten, die gesamte Bevölkerung, im Keller der Schule festgehalten, zusammengepfercht auf einer Fläche von weniger als zweihundert Quadratmetern. Siebzig dieser Dorfbewohner waren Kinder, das jüngste ein Säugling.
Jahidne wurde im April 2022 deokkupiert, und ich besuchte den Ort im September desselben Jahres. Im Erdgeschoss hatten die russischen Soldaten das Mobiliar zerstört. An den Wänden hinterließen sie entmenschlichende Schmierereien über Ukrainer. Es gab keinen Strom. Im Licht der Taschenlampe meines Smartphones tastete ich mich in den Keller vor und inspizierte die Wandzeichnungen der Kinder dort. Ich konnte lesen, was sie geschrieben hatten («Nein zum Krieg»); meine Kinder halfen mir später, die Figuren zu identifizieren (beispielsweise einen Hochstapler aus dem Spiel Among Us).
An einem Türrahmen entdeckte ich zwei mit Kreide geschriebene Listen mit den Namen derjenigen, die umgekommen waren: auf der einen Seite diejenigen, die hingerichtet wurden (soweit ich sehen konnte, waren das siebzehn); auf der anderen diejenigen, die an Erschöpfung oder Krankheit gestorben waren (das waren zehn).
Zu dem Zeitpunkt, als ich in Jahidne ankam, befanden sich die Überlebenden nicht mehr im Keller. Waren sie frei?
Eine Befreiung suggeriert ein Leid, das sich verflüchtigt hat. Aber die Erwachsenen brauchen Unterstützung, die Kinder eine neue Schule. Es ist unglaublich wichtig, dass die Stadt nicht mehr besetzt ist. Aber es wäre falsch, die Geschichte von Jahidne mit dem Moment zu schließen, in dem die Überlebenden aus dem Untergrund auftauchten, oder die Geschichte von Posad-Pokrovske mit dem Ende der Bombardierung.
Der Herr, dem der Schlüssel für die Schule in Jahidne anvertraut war, bat um Hilfe beim Bau eines Spielplatzes. Inmitten eines zerstörerischen Krieges mag das wie ein seltsamer Wunsch erscheinen. Die Russen töten Kinder mit Raketen und kidnappen sie, um sie zwangsweise zu Russen zu machen. Aber dass diese Verbrechen nicht mehr da sind, reicht nicht; Deokkupation genügt nicht. Kinder brauchen Orte zum Spielen, zum Laufen, zum Schwimmen, Orte, um sich selbst zu verwirklichen. Ein Kind kann keinen Park und kein Schwimmbad bauen. Die Freude der Jugend besteht darin, solche Dinge in der Welt zu entdecken. Es bedarf kollektiver Arbeit, um Strukturen der Freiheit zu schaffen, für die Jungen genauso wie für die Alten.
—
Ich bin während des Krieges in die Ukraine gekommen, weil ich dieses Buch über Freiheit schreiben wollte. Hier ist das Thema allerorten greifbar. Einen Monat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sprach ich mit einigen ukrainischen Parlamentariern: «Wir haben uns für die Freiheit entschieden, als wir nicht geflohen sind.» «Wir kämpfen für die Freiheit.» «Die Freiheit selbst ist die Wahl.»
So redeten nicht nur die Politiker. Als ich zu Kriegszeiten in der Ukraine mit Soldaten, Witwen und Bauern, Aktivisten und Journalisten sprach, hörte ich immer wieder das Wort «Freiheit». Interessant war, wie sie es verwendeten. Da ein Großteil ihres Landes unter völkermörderischer Besatzung stand, hätten die Ukrainer, so könnte man annehmen, allen Grund gehabt, von Freiheit als Befreiung von, als Abwesenheit des Bösen zu sprechen. Das tat aber niemand.
Auf die Frage, was sie mit «Freiheit» meinten, nannte nicht eine einzige Person, mit der ich sprach, die Freiheit von den Russen. Ein Ukrainer erklärte mir: «Wenn wir ‹Freiheit› sagen, meinen wir nicht ‹Freiheit von etwas›.» Ein anderer definierte den Sieg als «für etwas zu sein, nicht gegen etwas». Die Besatzer hatten sich dem Gefühl in den Weg gestellt, dass die Welt sich öffnete, dass die nächste Generation ein besseres Leben haben würde, dass die jetzt getroffenen Entscheidungen in den kommenden Jahren von Bedeutung sein würden.
Es war wichtig, die Unterdrückung zu beseitigen, das zu erlangen, was Philosophen «negative Freiheit» nennen. Aber die Deokkupation, die Beseitigung des Leids, war nur eine notwendige Bedingung für die Freiheit, nicht die Sache selbst. Ein verwundeter Soldat in einem Rehabilitationszentrum sagte mir, bei der Freiheit gehe es darum, dass jeder die Chance hat, nach dem Krieg seine eigenen Ziele zu verwirklichen. Ein Veteran, der auf eine Prothese wartete, meinte, Freiheit wäre ein Lächeln auf dem Gesicht seines Sohnes. Ein junger Soldat auf Fronturlaub erklärte, Freiheit, das seien die Kinder, die er eines Tages haben werde. Ihr Oberbefehlshaber im versteckten Stabsraum, Walerij Saluschnyj, meinte zu mir, Freiheit bedeute ein normales Leben mit Perspektiven.
Freiheit, das war eine Zukunft, in der einige Dinge gleich blieben und andere besser waren. Sie bedeutete ein Leben, das sich ausdehnt und wächst.
—
In diesem Buch versuche ich, Freiheit zu definieren. Diese Aufgabe beginnt mit der Rettung des Wortes vor übermäßigem Gebrauch und Missbrauch. Ich fürchte, dass wir in meinem eigenen Land, den Vereinigten Staaten, von Freiheit sprechen, ohne wirklich darüber nachzudenken, was sie bedeutet. Amerikaner denken dabei oft an die Abwesenheit von etwas: von Besatzung, Unterdrückung oder sogar von Regierung. Ein Individuum ist frei, glauben wir, wenn die Regierung aus dem Weg ist. Negative Freiheit ist unser gängiges Verständnis.
Natürlich ist es verlockend, Freiheit als «wir gegen die Welt» zu betrachten, wie es der negative Freiheitsbegriff ermöglicht. Wenn die Schranken das einzige Problem sind, dann muss mit uns alles in Ordnung sein. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Wir glauben, wir wären frei, wäre nicht die Welt da draußen, die uns übel mitspielt. Aber reicht die Beseitigung von etwas in der Welt aus, um uns frei zu machen? Ist es nicht mindestens genauso wichtig, Dinge hinzuzufügen?
Wenn wir frei sein wollen, werden wir bejahen, nicht nur verneinen müssen. Manchmal werden wir zerstören müssen, aber sehr viel häufiger werden wir schöpferisch tätig sein müssen. Am häufigsten werden wir sowohl die Welt als auch uns selbst in Übereinstimmung bringen müssen, auf der Grundlage dessen, was wir wissen und wertschätzen. Wir brauchen Strukturen, und zwar genau die richtigen, sowohl moralische als auch politische. Tugend ist untrennbarer Bestandteil von Freiheit.
«Steinmauern machen kein Gefängnis / und Eisenstangen keinen Käfig» – sagt der Dichter. Manchmal tun sie es, manchmal aber auch nicht. Unterdrückung ist nicht nur eine Frage der Behinderung, sondern auch der menschlichen Absichten, die dahinter stehen. Im ukrainischen Donezk wurde eine verlassene Fabrik in ein Kunstlabor umgewandelt; unter russischer Besatzung wurde dasselbe Gebäude zu einer Foltereinrichtung. Der Keller einer Schule kann, wie in Jahidne, ein Konzentrationslager sein.
Die ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten befanden sich deshalb in Bars, Hotels und Burgen. Das erste feste KZ, Dachau, war eine aufgelassene Fabrik. Auschwitz war zuvor ein polnischer Militärstützpunkt, der die Menschen vor einem deutschen Angriff schützen sollte. Kozelsk, ein sowjetisches Kriegsgefangenenlager, in dem polnische Offiziere vor ihrer Hinrichtung gefangen gehalten wurden, war ein Kloster gewesen – und zwar genau das, in dem Fjodor Dostojewski in Die Brüder Karamasow den Dialog mit der berühmten Frage stattfinden lässt: Wenn Gott tot ist, ist dann alles erlaubt?
Keine höhere Macht macht uns frei, genauso wenig das Fehlen solch einer höheren Macht. Die Natur gibt uns die Chance, frei zu sein: nicht weniger und nicht mehr. Man sagt uns, dass wir «frei geboren» sind: Das stimmt nicht. Wir werden schreiend geboren, verbunden mit einer Nabelschnur und bedeckt mit dem Blut einer Frau. Ob wir frei werden, hängt von den Handlungen anderer ab, von den Strukturen, die diese Handlungen ermöglichen, von den Werten, die diesen Strukturen Leben einhauchen – und erst dann von einem Flackern der Spontaneität und dem Mut unserer eigenen Entscheidungen.
Die Strukturen, die uns behindern oder befähigen, sind physischer und moralischer Natur. Es ist wichtig, wie wir über Freiheit sprechen und denken. Freiheit beginnt damit, dass wir unseren Geist von falschen Ideen deokkupieren. Und es gibt richtige und falsche Ideen. In einer Welt des Relativismus und der Feigheit ist die Freiheit das Absolute unter den Absoluten, der Wert der Werte. Nicht weil Freiheit das eine Gut ist, dem sich alle anderen beugen müssen. Sondern weil Freiheit die Voraussetzung ist, unter der all die guten Dinge in und zwischen uns fließen können.
Freiheit ist auch kein Vakuum, das ein toter Gott oder eine leere Welt hinterlassen haben. Sie ist keine Abwesenheit, sondern eine Präsenz, ein Leben, in dem wir vielfältige Verpflichtungen wählen und Kombinationen davon in der Welt verwirklichen. Tugenden sind real, so real wie der Sternenhimmel; wenn wir frei sind, lernen wir sie, stellen sie zur Schau, erwecken sie zum Leben. Im Laufe der Zeit definiert unsere Wahl der Tugenden uns als Menschen mit Willen und Individualität.
—
Wenn wir davon ausgehen, dass Freiheit etwas Negatives ist, die Abwesenheit von diesem oder jenem, glauben wir, dass wir nur ein Hindernis beseitigen müssen. In dieser Denkweise ist die Freiheit der Normalzustand des Universums, der uns von einer höheren Macht gebracht wird, wenn wir den Weg frei machen. Das ist naiv.
Den Amerikanern wird beigebracht, dass uns die Freiheit durch unsere Gründerväter, unseren Nationalcharakter oder unsere kapitalistische Wirtschaft gegeben ist. Nichts davon stimmt. Freiheit kann nicht gegeben werden. Sie ist kein Erbe. Wir nennen Amerika ein «freies Land», aber kein Land ist frei. Der eritreische Dissident und Dichter Y.F.Mebrahtu wies einmal auf die unterschiedliche Rhetorik von Unterdrückern und Unterdrückten hin und bemerkte: «Sie reden vom Land, wir reden von den Menschen.» Nur Menschen können frei sein. Wenn wir glauben, dass etwas anderes uns frei macht, lernen wir nie, was wir tun müssen. In dem Moment, in dem wir glauben, dass Freiheit gegeben ist, ist sie weg.
Wir Amerikaner glauben gerne, dass Freiheit eine Frage der Beseitigung von Dingen ist und dass der Kapitalismus diese Arbeit für uns erledigt. Doch es ist eine Falle, an diese oder irgendeine andere äußere Quelle der Freiheit zu glauben. Wenn wir Freiheit mit äußeren Faktoren in Verbindung bringen, und uns jemand sagt, dass die Welt da draußen jetzt eine Bedrohung darstellt, dann opfern wir die Freiheit für die Sicherheit. Das erscheint uns sinnvoll, denn in unserem Herzen waren wir bereits unfrei. Wir glauben, dass wir Freiheit gegen Sicherheit eintauschen können. Das ist ein fataler Fehler.
Freiheit und Sicherheit gehen Hand in Hand. In der Präambel der amerikanischen Verfassung heißt es, dass neben dem «allgemeinen Wohl» und der «Landesverteidigung» auch das «Glück der Freiheit» zu erstreben sei. Wir müssen Freiheit und Sicherheit haben. Damit Menschen frei sein können, müssen sie sich sicher fühlen, insbesondere als Kinder. Sie müssen die Chance haben, sich gegenseitig und die Welt zu kennen. Als freie Menschen entscheiden sie dann, welche Risiken sie eingehen wollen, und aus welchen Gründen.
Als Russland in die Ukraine einmarschierte, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj seinem Volk nicht, dass es seine Freiheit gegen Sicherheit eintauschen müsse. Er sagte den Menschen, dass er im Land bleiben werde. Nach meinem Besuch in Jahidne sprach ich mit ihm in seinem Büro in Kyjiw, hinter vielen Sandsäcken. Er bezeichnete die Deokkupation als Chance, sowohl Sicherheit als auch Freiheit wiederherzustellen. Er sagte, dass der «Verlust der Freiheit Unsicherheit» und dass «Unsicherheit der Verlust der Freiheit» sei.