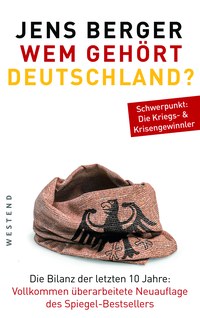Mein Haus, mein Auto, mein Boot: Die Probleme der Vermögensstatistiken
Wissen Sie eigentlich, wie vermögend Sie sind? Diese Frage ist keineswegs profan, und sicherlich kann sie niemand aus dem Stegreif beantworten. Wie misst man überhaupt Vermögen? Was ist das eigentlich? Und was heißt Reichtum? Wenn Sie bei diesen Fragen stocken, ist das vollkommen normal – und zwar nicht, weil man so fürchterlich reich ist, dass man glatt den Überblick über Hab und Gut verloren hat. Vermögen ist etwas Abstraktes. Es zu messen und zu definieren, was Reichtum ist und wo er anfängt, ist kein einfaches Unterfangen.
Was ist Vermögen?
Bevor man sich an die Fragen der Vermögensverteilung begibt, um eine Ahnung davon zu bekommen, wem Deutschland gehört, muss man den Begriff Vermögen überhaupt erst einmal verstehen. Der Duden definiert Vermögen als »gesamten Besitz, der einen materiellen Wert darstellt«, und trifft damit mit wenigen Worten den Kern. »Materiell« heißt in diesem Kontext, dass etwas einen Marktwert hat, es verkäuflich ist. Ideelle Werte spielen bei der Definition von Vermögen also keine Rolle. Auch wenn Sie noch so wertvolle Erinnerungen mit der alten, kaputten Uhr ihres Großvaters verbinden, die Sie einst von ihm geerbt haben – in eine Vermögensaufstellung geht nur der Wert der Uhr ein, zu dem Sie diese jemandem verkaufen könnten, der keine Emotionen mit ihr verbindet. Obgleich kaum ein Thema derart emotional betrachtet wird wie die Frage von Reichtum und Armut, so geht es bei Vermögensstatistiken nicht um Emotionen, sondern um kalte, nackte Zahlen.
In der Umgangssprache wird Vermögen oft mit dem Geldvermögen gleichgesetzt. Offenbar schwirrt hier in den Köpfen immer noch Onkel Dagoberts Geldspeicher herum. Doch Vermögen ist mehr als Geld und weitaus mehr als die schwarze Zahl auf dem Girokonto. Die Geldvermögen spielen bei der Gesamtvermögensaufstellung eine wichtige, aber keinesfalls dominante Rolle. Elon Musk ist sicherlich nicht der reichste Mensch der Welt, weil er unglaublich viel Geld in seinem Portemonnaie oder auf seinem Girokonto hat, und in einem Geldspeicher badet er auch nicht. Es könnte sogar sein, dass er gar kein Portemonnaie besitzt und sein Konto im Minus ist. Doch das ist unerheblich, wenn man wie Elon Musk Aktienpakete im dreistelligen Milliardenwert besitzt und bei jeder Bank der Welt eine Kreditkarte ohne Limit ausgestellt bekommt.
Es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Vermögens und der Art und Weise, wie es sich zusammensetzt. Sortiert man die Bewohner Deutschlands nach ihrem Vermögen, entdeckt man, dass die Geldvermögen, darunter in besonderer Weise das Girokonto und die klassischen Sparkonten, vor allem bei vergleichsweise ärmeren Bevölkerungsschichten den größten Vermögensposten1 neben dem Auto darstellen. Aktien, Fondsanteile, Betriebsvermögen und sogar die private Altersvorsorge spielen für Ärmere hingegen keine nennenswerte Rolle.
Je wohlhabender die Menschen sind, desto wichtiger wird in der persönlichen Vermögensaufstellung die selbst genutzte Immobilie. Bei der gesamten Mittelschicht, also dem Bereich zwischen 40 und 90 Prozent der Vermögensverteilung, ist die selbst genutzte Immobilie der mit großem Abstand wichtigste Vermögenswert. Nicht Gold, sondern Betongold ist das eigentliche Vermögen der übergroßen Mehrheit der Deutschen.
Erst bei den oberen 10 Prozent der Vermögensskala, also den Wohlhabenden der Republik, nehmen auch Vermögenswerte wie nicht selbst genutzte, also vermietete, Immobilien und Betriebsvermögen eine wichtige Rolle ein. Interessant ist, dass selbst bei den Wohlhabenden das Geldvermögen im Durchschnitt geringer ist als der Wert der selbst genutzten Immobilie. Dies kehrt sich erst bei den wirklichen Reichen, dem obersten Prozent in der Vermögensverteilung, um. Hier spielen dann meist Betriebsvermögen und Aktien, aber auch vermietete Immobilien die dominante Rolle.
Da fast ausschließlich die vermögenderen Haushalte nicht selbst genutzte Immobilien und Betriebsvermögen besitzen, ist es nicht verwunderlich, dass sowohl das Immobilien- als auch das Betriebsvermögen in Deutschland besonders ungleich verteilt sind. Eine genaue Aufstellung der Vermögenspositionen der Bewohner Deutschlands zeigt folgende Tabelle, deren Basiswerte aus der PHF-Studie der Bundesbank stammen.2
Aufteilung des Vermögens in Deutschland 2021
Zu dieser Tabelle ist anzumerken, dass die Werte innerhalb der nach ihrem Nettovermögen sortierten Bevölkerungsgruppen jeweils Durchschnittswerte sind und daher hauptsächlich in der obersten, aber auch in der untersten Gruppe mit Vorsicht zu genießen sind. Zur generellen Aussagekraft dieser Daten kommen wir später.
Was ist eigentlich der Wert einer Sache?
Wenn der Duden von »materiellen Werten« spricht, so lässt dies Fragen offen. Niemand wird daran zweifeln, dass ein Haus oder ein Auto einen Wert hat. Welchen Wert diese materiellen Gegenstände besitzen, ist jedoch eine Frage der Interpretation. Anders als in den Naturwissenschaften, in denen jeder Wert eine klar definierte physikalische Größe ist, gibt es in den Wirtschaftswissenschaften unterschiedliche Vorstellungen:
Die klassischen Ökonomen definierten den Wert anhand der Arbeitszeit, die gesellschaftlich notwendig ist, um eine Ware herzustellen. Diese Interpretation, die ihren Höhepunkt in Marx’ Arbeitswertlehre fand, lässt jedoch grundlegende Fragen offen. Warum ist ein Gemälde von Picasso ungleich wertvoller als das Gemälde eines Dilettanten? Die investierte Arbeitszeit hat damit jedenfalls nichts zu tun. Warum ist ein Haus mit unverbaubarem Seeblick wertvoller als ein Haus mit Blick auf ein Stahlwerk? Auch hier liefert die Reduzierung auf die investierte Arbeit keine befriedigende Antwort.
Das andere Extrem stellt die sogenannte Grenznutzenschule dar, die den Nutzen zum Maß aller Dinge erhebt und damit mit voller Kraft ins Wertparadoxon steuerte. Warum ist ein Diamant, der keinen erkennbaren Nutzen hat, so viel wertvoller als ein Liter Wasser? Letztlich konnte dieses Paradoxon dadurch entschärft werden, indem man den objektiven Nutzen vom subjektiven Nutzen trennte. So kann der Diamant ohne objektiven Nutzen sehr wohl einen sehr hohen subjektiven Nutzen und damit einen hohen Preis haben – nur weil er so schön glitzert und unsere Mitmenschen neidisch dreinblicken lässt.
Neoliberale Ökonomen machen es sich bei dieser Frage einfach: Für sie ist der Preis, also der Wert, den die Märkte einem Gut zumessen, auch der Wert dieses Gutes. Das kommt zwar einer befriedigenden Definition schon sehr nah, aber auch Märkte können irren. Wenn die neoliberale Definition zutreffend wäre, dann war eine einzige Tulpe der Sorte Viceroy zum Höhepunkt der Amsterdamer Tulpenmanie im Februar 1637 tatsächlich so viel wert wie 670 Scheffel Weizen oder eines der teuersten Häuser in Amsterdam.3 Gerade in Zeiten von Blasen an den Finanz- oder Immobilienmärkten ist diese Definition daher mit Vorsicht zu genießen. Dummerweise merkt man erst, wenn die Blase geplatzt ist, dass die Marktpreise Blasenpreise sind.
Unabhängig von diesen eher theoretischen Betrachtungen ist der Unterschied zwischen Wert und Preis auch bei der heutigen Betrachtung der Vermögen elementar. Marktwerte sind lediglich eine theoretische Momentaufnahme. Eine Sache ist nur dann wirklich so viel wie ihr Preis wert, wenn sie zu diesem tatsächlich ver- oder gekauft wird. Gerade bei den selbst bewohnten Immobilien, die ja die Säule des Vermögens der meisten Deutschen sind, ist das nicht unproblematisch, da der »tatsächliche Wert« erheblich von diesem »angenommenen Wert« abweichen kann – besonders wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Seit der Zinswende, die Immobilienkredite deutlich verteuert hat, ist dies spürbar. Ähnlich komplex gestaltet sich die Wertbestimmung bei den Betriebsvermögen: Wie viel ein Unternehmen wirklich wert ist, kann der Besitzer erst dann mit Sicherheit wissen, wenn er einen Käufer gefunden hat, der bereit ist, exakt diesen Preis zu zahlen.
Ein besonderer Unsicherheitsfaktor bei der Vermögensberechnung besteht darin, dass vor allem die Geldvermögen aus ökonomischer Perspektive Forderungen sind. Der Wert einer Lebensversicherung stellt eine Forderung gegenüber der Versicherungsgesellschaft dar, die wiederum die Beiträge ihrer Kunden an andere verliehen hat und daher selbst auf einem ganzen Haufen von Forderungen sitzt. Auch das Geld auf dem Girokonto oder dem Sparbuch ist eine Forderung – in diesem Fall gegen die Bank. In der Regel gehen diese Forderungen mit dem vollen Wert in der Vermögensbilanz ein. Dies mag bei Girokonten und Sparbüchern, solange sie von der Einlagensicherung betroffen sind, gerechtfertigt sein. Eine Lebensversicherung, die bei jüngeren Versicherten erst in ferner Zukunft ausgezahlt wird, mit dem vollen Zeitwert zu bewerten, ist jedoch ein fragwürdiges Unterfangen. Da es keinen echten Markt für diese Papiere gibt, müssten sie eigentlich bei seriöser Betrachtung eher zum wesentlich niedrigeren Rückkaufswert bilanzieren.
Vermögensbilanzen sind daher stets Momentaufnahmen und beruhen auf Daten, die in der Regel einen Erwartungswert darstellen. Wenn sich diese Erwartungen in der Zukunft nicht erfüllen, können sich diese Werte massiv verschieben.
Reiche Arme und arme Reiche
Während der Vermögensbegriff trotz unterschiedlicher Definition immer noch greifbar ist und man sich mit ein wenig gutem Willen auf eine Definition einigen könnte, ist der Begriff Reichtum vollends schwammig. Erstaunlicherweise hat sogar die Wissenschaft ihre Probleme damit. Während das Gegenteil, nämlich die Armut, relativ klar umrissen ist, gibt es für den Begriff Reichtum keine allseits anerkannte Definition. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen ist der Begriff Armut nicht über das Vermögen der betreffenden Personen definiert, sondern über das Einkommen. Wer arm ist, verfügt in der Regel ohnehin über kein nennenswertes Vermögen. Umgekehrt muss eine Person ohne nennenswertes Vermögen nicht zwingend arm sein. Wer beispielsweise über ein fürstliches Einkommen verfügt und das komplette Geld auf den Kopf haut, ohne sich davon irgendwelche Vermögenswerte zu kaufen, hat ebenfalls kein messbares Vermögen, gehört dennoch nicht zu den Armen der Gesellschaft.
Diese »reichen Armen« sind in Zeiten der horrenden Mietpreise in den Metropolen keine Seltenheit. Wer beispielsweise über ein hohes Einkommen verfügt, aber gleichzeitig eine hohe Miete zahlen muss und den Rest des Einkommens für Konsum und Freizeit ausgibt, steht – so paradox es klingen mag – in der reinen Vermögensstatistik mit dem Hilfsarbeiter, der von seinem geringen Einkommen eine niedrige Miete zahlen muss und den Rest für Konsum und Freizeit ausgibt, auf derselben Stufe. Doch dies sind zugegebenermaßen eher Ausnahmen. Folgt man den Vermögensstatistiken der Bundesbank, besteht die größte gemessene Korrelation zur Höhe des Vermögens in der Tat zu einem hohen Einkommen. Die obersten 10 Prozent der Einkommensskala besitzen mit durchschnittlich 1060200 Euro ein Nettovermögen, das deutlich über dem Durchschnitt liegt.
Es gibt jedoch auch die »armen Reichen«, und die sind trotz eines hohen Vermögens in der untersten Einkommensskala zu finden. Wer zu den unteren 20 Prozent der Einkommensskala gehört, verfügt im Median, also im Mittelwert, nur über ein Nettovermögen in Höhe von 10500 Euro. Es gibt in dieser Gruppe folglich genau so viele Haushalte, die weniger und die mehr als 10500 Euro Vermögen haben. Interessanterweise ist das durchschnittliche Nettovermögen dieser Gruppe mit 103500 Euro fast zehnmal so hoch wie der Median. Wenn der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt derart groß ist, deutet dies darauf hin, dass einige wenige Haushalte mit einem sehr hohen Vermögen den Durchschnitt extrem verzerren. Gibt es wirklich Haushalte mit einem sehr hohen Vermögen, die über keine oder nur geringe Einkommen verfügen? Oh ja, die gibt es.
Diese Personen haben in der Tat kein nennenswertes Einkommen und verzehren im wahrsten Sinne des Wortes ihr Vermögen. Zu diesen »armen Reichen« gehören nicht nur Erben, sondern oft auch ehemalige Selbstständige und Freiberufler, die es versäumt haben, in die klassischen Altersvorsorgesysteme einzuzahlen, und im Alter von ihren Ersparnissen leben. Wie bereits erwähnt – an den Rändern, oben wie unten, wird es bei der Vermögensverteilung oft unscharf. Doch sowohl die »reichen Armen« als auch die »armen Reichen« sind eher eine statistische Randnotiz – die man nicht ausblenden sollte, wenn man sich mit dem Thema Vermögensverteilung beschäftigt. Denn man stößt immer wieder auf Daten, die nicht ins Bild passen, wenn man nicht um die Ecke denkt.
Die armen Armen
Wie sieht es mit den »armen Armen« aus? Der Begriff Armut ist aus den bereits genannten naheliegenden Gründen nicht über das Vermögen, sondern über das Einkommen definiert. In den Industriestaaten geht es dabei vorwiegend nicht um die absolute Armut – obgleich es sie auch hierzulande gibt –, wie man sie hauptsächlich aus den Entwicklungsländern kennt, sondern um die relative Armut. Maßstab ist hierbei das, was die Wissenschaft den Median des Nettoäquivalenzeinkommens nennt. Das klingt kompliziert – und ist es auch.
Es macht einen großen Unterschied, ob man mit einem Haushaltseinkommen von 3000 Euro netto nur sich selbst in einem Single-Haushalt oder eine sechsköpfige Familie ernähren muss. Daher ist das reine Haushaltseinkommen ohne Kontext keine geeignete Größe, um Armut zu definieren. Stattdessen haben die Statistiker sich das sogenannte Äquivalenzeinkommen einfallen lassen, um ansonsten nicht Vergleichbares vergleichbar zu machen.
Das Äquivalenzeinkommen ist ein bedarfsgewichtetes Pro-Kopf-Einkommen je Haushaltsmitglied. Um Äquivalenzeinkommen zu bestimmen, wird das Haushaltsnettoeinkommen durch die Summe der »Bedarfsgewichte« der im Haushalt lebenden Personen geteilt: Die erste erwachsene Person bekommt stets das Gewicht 1, weitere Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren erhalten das Gewicht 0,5, Kinder unter 14 Jahren das Gewicht 0,3. Eine Familie mit zwei Kindern unter 14 hat also das Bedarfsgewicht 2,1. Wenn das Nettohaushaltseinkommen dieser Familie 4500 Euro pro Monat beträgt, beträgt das Nettoäquivalenzeinkommen 2143 Euro (4500 ÷ 2,1). Der Median wiederum ist der mittlere Wert einer aufsteigend geordneten Datenreihe – das heißt beim Einkommen, dass die eine Hälfte der Bevölkerung mehr, die andere Hälfte weniger zur Verfügung hat. Für das Jahr 2022 betrug der Median des Nettoäquivalenzeinkommens in Deutschland 25000 Euro pro Jahr, also 2083 Euro pro Monat.4 Unsere Familie aus dem Rechenbeispiel liegt also etwas über dem Median und gehört damit nicht zu den armen Familien.
Die EU definiert Armut folgendermaßen: Wer weniger als 70 Prozent des Nettoäquivalenzeinkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet in sozialen Risikosituationen, wer weniger als 60 Prozent hat, gilt als allgemein armutsgefährdet, wer weniger als 50 Prozent hat, gilt als relative einkommensarm, und wer weniger als 40 Prozent hat, gilt schließlich als arm. WHO und OECD haben die Armutsgrenze mit 50 Prozent ein wenig höher definiert. Nach der EU-Definition wäre unsere Familie mit den zwei kleinen Kindern also ab einem Haushaltseinkommen von weniger als 3062 Euro armutsgefährdet und nach WHO/OECD-Definition mit weniger als 2188 Euro arm.
Armut ist in Deutschland politisch durchaus akzeptiert. Die Durchschnittsrente liegt mit 1316 Euro bei Frauen sogar unter dem EU-Schwellenwert für die Armutsgefährdung. Und wir reden hier vom Durchschnitt und nicht von den Millionen Rentnern am unteren Ende der Rentenskala. Da kann es nicht verwundern, dass in Deutschland 13,2 Millionen Menschen, also 16,1 Prozent der Bevölkerung, armutsgefährdet sind.5 Besonders verbreitet ist Armut bei Alleinlebenden – hier gilt mehr als ein Viertel als armutsgefährdet. Und bei den Erwerbslosen sind es sogar mehr als die Hälfte.
Während es zahlreiche Studien zur Armut in Deutschland gibt, klafft bei den Studien über den Reichtum ein akademisches Loch. Sogar der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung trägt zwar den »Reichtum« im Titel, gibt jedoch nur sehr eingeschränkte Informationen über die wirklich Reichen preis. Das hat mehrere Gründe, der profanste lautet: Es gibt schlichtweg keine verlässlichen Daten zu den Reichen und Superreichen. Wer eine Sozialleistung vom Staat in Anspruch nehmen will, muss sich zuvor sprichwörtlich nackt machen und dem prüfenden Amt seine Einkommens- und Vermögenswerte bis ins kleinste Detail offenlegen. Der Staat weiß daher zwar nicht alles, aber doch sehr viel über die Armen im Lande. Über die Reichen weiß er jedoch so gut wie nichts und will daran offenbar nichts ändern.