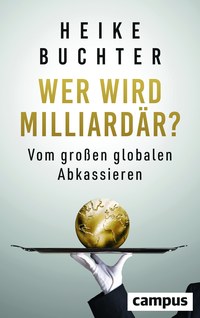Es ist ihre Welt. Wir leben nur darin
Vorbei an alten Steinmauern, grauen Cottages und grasenden Schafen schlängelt sich die Landstraße immer weiter in das Tal des Feshie. Der Fluss, tief in seinem steinigen Bett im schottischen Hochland nicht weit von Loch Ness, ist im Vorbeifahren mehr zu ahnen als zu sehen. Kommt ein Auto oder gar ein Minivan entgegen, heißt es hoffen, dass gerade eine Passing Zone auftaucht, also etwas Platz am Rand ist, und sich die Fahrzeuge nicht touchieren. Während mein Herz als Mietwagenfahrerin (ein nagelneuer Peugeot 2008!) dabei schneller schlägt, scheinen die Einheimischen – meist nett lächelnd – auf dem Gas zu bleiben. Bald sind fast nur noch Wanderer und Radfahrer unterwegs. Gerade als die Fichten und Birken den Blick freigeben auf verschneite Bergrücken, ein Bild wie gemacht für die Whiskey-Werbung, versperrt ein Gatter die Straße. Auf einem Schild daneben warnt eine Einrichtung namens WildLand: »Keine Durchfahrt ohne Genehmigung, please.«
WildLand ist das Unternehmen von Anders Povlsen, einem dänischen Modefabrikanten, zu dessen Marken Vero Moda und Jack&Jones gehören. Auch mehr als zehn Prozent des deutschen Onlinehändlers Zalando finden sich in seinem Portfolio. Umweltschützer sind nicht begeistert von Povlsens Produkten, sie zählen sie zur sogenannten Fast Fashion, Kleidung, die schnell produziert wird, um von Trends zu profitieren. Aktivisten machen das Geschäftsmodell maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Modeindustrie jährlich nicht nur 100 Milliarden Kleidungsstücke herstellt, sondern gleichzeitig rund 100 Millionen Tonnen davon weggeworfen werden. Anders ausgedrückt: Ein Lkw voller Kleidung landet jede Sekunde auf der Müllhalde. Für Povlsen, der mit 28 Jahren ein kleines Bekleidungsgeschäft in der dänischen Provinz von seinen Eltern übernahm, hat es sich gelohnt. Laut Forbes belief sich sein Vermögen Anfang 2023 auf sieben Milliarden US-Dollar. Dieser Reichtum hat Povlsen in die Lage versetzt, sich vor einigen Jahren Glenfeshie, das Tal des Feshie, zu kaufen. So gut wie alles, was man hier ringsherum sieht, inklusive einer Sammlung herrschaftlicher Jagdanwesen, gehört ihm und seiner Frau Anne.
Glenfeshie ist nur eines der Estates, der Ländereien, die der Däne in seinen Besitz gebracht hat. Vor ein paar Jahren hat er weite Teile des nördlichsten Gipfels der schottischen Highlands erworben, unter anderem einst das Herrschaftsgebiet der Herzöge von Sutherland. Povlsen ist inzwischen der größte Grundbesitzer in Schottland, ihm gehört hier mehr Land als König Charles oder der englischen Kirche. Doch nur wenige Menschen, die hier leben, sind dem Dänen bisher begegnet. »Der fliegt immer mal wieder ein«, glaubt die Kellnerin im Cairngorm Hotel in der kleinen Stadt Aviemore, das weiter unten im Tal liegt. Sie kennt Povlsen nicht, erklärt sie, nur ihr Mann habe ihn ein paar Mal gesehen, als er für Povlsens Estate in Glenfeshie arbeitete. Sie räumt die spärlichen Reste des Cooked English Breakfast mit Rührei und Yorkshire Pudding ab. Bevor sie die Teller in die Küche trägt, sagt sie: »Schon verrückt, dass ein Einzelner einfach so ganze Landstriche kaufen kann, oder?«
Ja, es ist verrückt, dass in unserer angeblich modernen Zeit mitten in Europa Strukturen entstehen, die an die Feudalherrschaft erinnern. Oder an Kolonialismus. Nur, dass die Kolonialisierung nicht durch einen Staat geschieht, sondern durch Einzelne: Milliardäre.
Ihre Zahl ist über die vergangenen 20 Jahre stetig gestiegen. 2640 gibt es laut den jüngsten Erhebungen des US-Magazins Forbes weltweit. Ihnen gehören nicht nur Grundbesitz und Immobilien. Sie sind Eigentümer von Konzernen quer über alle Kontinente und Branchen. Ihnen gehören Autobahnen, Flughäfen und Wasserrechte. Sie halten Patente auf Medikamente und Technologien. Von ihnen finanzierte Stiftungen prägen Kunst und Kultur, ihre Denkfabriken und Spenden beeinflussen unsere Gesellschaft und Politik. Während ihr Einfluss wächst, bleiben die Herrscher des Geldes zunehmend unter sich.
Miami im Februar 2023. Die Stadt im Sunshine State Florida galt lange als zu heiß, zu laut und zu bunt, um die Geldelite anzulocken. Die Pandemie hat auch das geändert. Das liegt mit daran, dass Miami es den Multimillionären und Milliardären erlaubt, sich in ihren Anwesen auf privaten Inseln wie Fisher Island oder dem künstlich angelegten Star Island zu verschanzen, zu denen niemand ohne Erlaubnis Zugang erhält. »Vor dem Haus steht der Lamborghini, dahinter wartet der Sikorsky«, fasst es der Taxifahrer zusammen, der mich zur Miami International Boat Show bringt, der größten Bootsmesse der USA und einem der wichtigsten Treffen der Branche. Denn was den wahren Reichtum ausmacht, ist nicht nur das entsprechende Auto oder der Helikopter, sondern vor allem eine Yacht. Die Pandemie hat die Nachfrage nach den Luxusbooten so angetrieben, dass es Wartelisten gibt und viele der Werften volle Auftragsbücher bis 2024 und darüber hinaus haben. Entsprechend ist der Andrang. Es ist viel Italienisch zu hören, was daran liegt, dass Werften darunter sind wie die Ferretti Group aus Forlí, die inzwischen in Hongkong an der Börse gelistet ist und zu den führenden Anbietern gehört. In Miami stellt Ferretti die neue Serie mit Panoramafenstern von der Decke bis zum Boden vor. Gleich daneben lässt Konkurrent Azimut Benetti, aus Viareggio in der Toskana, seine Modelle ankern, vor denen sich zwei blondierte Besucherinnen fotografieren lassen. Gleich mit 16 »aufsehenerregend modernen« Yachten ist Azimut dieses Jahr vertreten, wie das Magazin Yacht Harbour berichtet. Auch die Superyachten gehören bei der Messe zum Angebot, allerdings muss man die erst einmal finden.
Weitab von dem Gedränge an den Marinas und den Zelten mit Anbietern von Entsalzungsanlagen, Hängematten und Motoren liegt der Yacht Haven Grande Miami. Das Wassertaxi, das Besucher dorthin bringt, bietet nicht viel Platz. Zwei Helfer stehen parat, um den Gästen aus dem Wassertaxi auf den Steg zu helfen. Dort schaukeln etwa ein Dutzend Superyachten. So bezeichnet die Branche traditionell Yachten mit einer Länge von mehr als 24 Metern – in der Regel nach den Wünschen des (ersten) Kunden gebaut. Weil es Yachten in dieser Länge nun auch »von der Stange« gibt und sie an Exklusivität einbüßten, gelten 30 Meter nun als der neue Standard. Die Pandemie hat die Nachfrage kräftig angeschoben. Orders für 1024 neue Superyachten fanden sich 2022 in den Auftragsbüchern der Werften, 25 Prozent mehr als 2021. Wer nicht jahrelang warten will, kauft gebraucht.
Vor der Patience, 40 Meter lang und vor zehn Jahren in Italien bei Benetti vom Stapel gelaufen, sitzt eine junge Frau unter einem Sonnenschirm. Eigentlich will sie nicht mit der Presse sprechen, denn Diskretion ist das oberste Gebot in dieser Welt. Dafür wird gut gezahlt. Bis vor einem halben Jahr gehörte sie als 2nd Officer zur Crew einer Superyacht. Der Monatsverdienst für diese Führungsposition an Bord liegt laut Yacht Crew bei bis zu 8000Euro im Monat – plus Trinkgeld, das mehrere Tausend Euro zusätzlich betragen kann. Jetzt hat sie eine einjährige Tochter, ist wieder an Land und arbeitet für eine Maklerfirma, wie sie es ausdrückt. Nur ernst zu nehmende Interessenten darf sie an Bord lassen. Und wie findet sie heraus, wer sich die Patience im Zweifel tatsächlich leisten kann und wer nur ein neugieriger Tourist ist? An der Kleidung? Sie schüttelt den Kopf. Sie habe schon Milliardäre in Klamotten von Target getroffen, einer Kaufhauskette. Die meisten verraten sich selbst. Etwa der angebliche Käufer, der »so an die 100 Leute« auf die Patience einladen wollte. Zugelassen sind auf privaten Yachten laut der US-Küstenwache maximal 12 Gäste plus Mannschaft. Wer mehr befördert, muss als Passagierschiff zugelassen werden. Was als Sicherheitsmaßnahme begann, macht die Luxusyachten heute noch exklusiver. Dieses Detail nicht zu kennen entlarvte den Mann als Möchtegern-Milliardär.
So beeindruckend die Superyachten sind, sie wirken plötzlich wie Beiboote, geht man den Steg des Yachthafens weiter entlang. Dort ragen die Gigayachten auf. Die Kismet, 95 Meter lang, und die Ahpo, mit 115 Metern fast so lang wie eine Fregatte der Marine, suchen auf der Messe neue Eigentümer. Beide stammen von der Lürssen Werft in Bremen-Vegesack, die auf diese schwimmenden Paläste spezialisiert ist, die zweite Sparte der Gruppe baut Kriegsschiffe und Patrouillenboote. (Die Eigentümerfamilie Lürßen hat es damit immerhin auf ein Vermögen von 800 Millionen Euro gebracht.)
Vor der Kismet laden Crew-Mitglieder Bouquets mit frischen Orchideen aus. Sie gehört dem pakistanisch-amerikanischen Geschäftsmann Shahid Khan, der sein Vermögen mit Stoßstangen für Pick-ups gemacht hat. Auf ihr ist Platz für 12 Gäste und 28 Crewmitglieder, die ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen dürften.Die Ahpo ankert schräg gegenüber und hat offenbar bereits Interessenten an diesem Morgen. Sie kommen gerade die Gangway herunter, beide in Marina Casual, er in Shorts mit frisch gebügeltem hellem Hemd, sie im kurzen schwarzen Kleid, dazu offenbar Sohn und Tochter sowie verschiedene Berater im Schlepptau.
Noch gehört die Ahpomit ihren verschiedenen Pools, Kino, Dancefloor und Schönheitssalon dem Milliardär Michael Lee-Chin, einem kanadischen Finanzier mit Wurzeln in Jamaika. Das Schiff, dessen Name sich auf Lee-Chins Großmutter bezieht, ist für 330 Millionen Euro zu haben. Das ist etwa 50000-mal so viel, wie ein Normalverdiener in Lee-Chins Heimat Jamaika im Jahr verdient. Dafür gibt es den ultimativen Luxus. Für die Käufer ist es eine eigene schwimmende Insel, die garantiert, dass kein Unbefugter Zutritt erhält. Für den Rest der Welt ist es das ultimative Symbol für das Auseinanderbrechen unserer Gesellschaft.
Nicht nur haben die Vermögen neue finanzielle Dimensionen erreicht, die kaum mit dem menschlichen Verstand zu erfassen sind. Fundamental geändert hat sich auch, wie man reich wird. Jeff Bezos und Bill Gates, die Amazon respektive Microsoft in Garagen gründeten, zählen zu den reichsten Menschen der Welt. Doch ihre Milliarden verdanken sie schon längst nicht mehr ihrem unternehmerischen Einfallsreichtum, sondern den Mechanismen der Finanzmärkte. Zu den Superreichen gehören außerdem zunehmend Menschen, die kein Produkt erfunden, kein Start-up zum Großkonzern geführt haben, sondern die schlicht mit viel Geld immer mehr Geld scheffeln.
Das hat Folgen für den Rest der Menschheit. Es ist nicht nur die ungleiche Verteilung des Wohlstands. Es ist auch die ungerechte Zuteilung der Fortschrittsgewinne. Arbeitnehmer profitieren immer weniger von technologischen Errungenschaften und der Gründung neuer Unternehmen. Stattdessen sind sie allzu oft die Verlierer, wenn Innovationen die Automatisierung und den Verlust von Arbeitsplätzen vorantreiben, während die Gründer in die Vermögens-Stratosphäre abheben. Inzwischen hat die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit Ausmaße angenommen, die nicht nur unseren westlichen Lebensstandard, sondern auch unsere Demokratie, ja schließlich unsere Existenz auf diesem Planeten gefährden.
Dabei macht die Ungleichheit auch vor den Reichen nicht halt. Wealth-X, eine Marktforschungsfirma, durchleuchtet die Superreichen und gibt einmal im Jahr den Billionaire Census heraus. Der Sinn, in den Worten der Herausgeber: »Die umfassende Datenbank von Wealth-X bietet einen unübertroffenen Einblick in den Status der weltweit vermögendsten Personen und ihre Eigenschaften, was sie zu einer unverzichtbaren Lektüre für alle Anbieter macht, die sich um Personen aus dieser außerordentlich exklusiven Gruppe bemühen und mit ihnen in Kontakt treten wollen.«
Diesem Billionaire Census zufolge konzentriert sich immer mehr Vermögen an der Spitze. »Die Milliardäre machen weniger als 1 Prozent der weltweiten Superreichen aus, besitzen jedoch 24 Prozent des Gesamtvermögens dieser Gruppe«, heißt es dazu in dem Bericht von 2023. Das bedeutet im Klartext: Die Milliardäre lassen nicht nur Normalsterbliche immer weiter hinter sich, sondern auch Reiche. Was die Verteilung des Reichtums unter den Milliardären betrifft, so gehört etwas mehr als die Hälfte zur »untersten« Vermögensstufe der Milliardäre, mit einem Nettovermögen von »nur« ein bis zwei Milliarden Dollar. Ein weiteres Drittel verfügt über ein Nettovermögen von zwei bis fünf Milliarden Dollar. Zusammengenommen kontrolliert diese Kohorte von 85 Prozent der Milliardäre weniger als die Hälfte des gesamten Milliardärsvermögens.
Die Konzentration an der Spitze dieser Pyramide hat ebenfalls zugenommen: 2016 verfügten die Super-Milliardäre, wie Wealth-X Personen mit mehr als 50 Milliarden Dollar Vermögen nennt, über rund vier Prozent des gesamten Vermögens aller Milliardäre. Nur drei Jahre später belief sich ihr Anteil bereits auf elf Prozent. Und im Jahr 2021 gehörten den reichsten 20 Individuen 17 Prozent des Milliardärsvermögens.
In diesem Buch geht es um einzelne Superreiche. Sie stehen beispielhaft für ihre Klasse, denn Milliardäre haben enormen Einfluss auf Umwelt, Wirtschaft, Finanzen, Politik, Kultur, Sport, Medizin – ja, eigentlich fällt einem kein Bereich ein, in dem sie nicht eine Rolle spielen. Und es ist wichtig, ihre Rollen zu beleuchten. Aber es geht auch um die Mechanismen, die Superreiche hervorbringen, und welche Folgen diese für uns alle haben. Darum, was sie in unserer Welt tun und ihr antun. Worum es nicht geht: Was Milliardäre uns erzählen wollen. Ihnen stehen genügend Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Ansichten kundzutun. Vielen gehören ganze Zeitungshäuser und TV-Stationen. Und sie haben überall das Ohr der Politik.
Wer wird Milliardär? Auf diese Frage gibt es eine kurze Antwort: wer die Kunst des Abkassierens beherrscht. Und eine umfangreichere in diesem Buch.