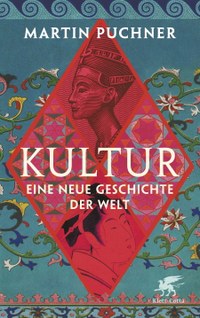Einleitung
Vor einem Jahr erzählte mir eine Freundin, nennen wir sie Karola, sie habe Geld geerbt. Von ihrem verstorbenen Vater. Es sei nicht allzu viel, aber doch zu viel, um es von der Inflation auffressen zu lassen. Renditegetriebene Aktien oder Fondsanteile kaufen wolle sie nicht und die Verzinsung auf dem klassischen Sparkonto sei ein Witz. Sie überlege daher, eine Wohnung zu kaufen. Nicht, um selbst einzuziehen. Sie wohne ja günstig. Sondern um für ihr Alter vorzusorgen. Sie sei jetzt schon Mitte fünfzig und müsse da irgendetwas tun. Der Blick auf den jährlichen Rentenbescheid trübe eher die Aussichten.
Einige Monate später habe ich sie wieder getroffen. Ob sie mittlerweile eine Wohnung gekauft habe, fragte ich sie. Ja, fast, sie sei mitten in den Verhandlungen mit der Immobilienmaklerin. Sie habe mehrere Wohnungen angeboten bekommen und besichtigt. Sie habe sich nicht wirklich gut gefühlt dabei. Da Karola sich keine teure Wohnung leisten konnte, war sie in der Regel auf Mieterinnen getroffen, deren Einnahmen so gering waren, dass sie eine Mieterhöhung kaum verkraftet hätten, von der Suche nach einer neuen Wohnung – bei möglicher Eigenbedarfskündigung – ganz zu schweigen, vom Verlust der vertrauten Umgebung sowieso. Da wegzumüssen, wo das Zuhause ist, für manche schon seit Jahrzehnten? Eine Zumutung.
Karola bat die Maklerin deswegen, ihr nur unvermietete Wohnungen anzubieten. »Die sind dann aber doch sehr viel teurer«, habe die erstaunt geantwortet. Zu teuer für Karola. Also schrieb sie der Maklerin eine Mail, sie möge bei jeder Besichtigung den betroffenen Mieterinnen vorab versichern, dass sie, die Kaufinteressentin, weder vorhabe, die Miete zu erhöhen, noch plane, selbst einzuziehen. Der Gedanke, dass sie für jemanden Grund schlafloser Nächte sein könnte, war für sie selbst Grund schlafloser Nächte.
Die Beruhigung der Maklerin, so erzählte Karola, habe nur wenig geholfen, die Mieterinnen seien ihr bei jeder Wohnungsbesichtigung verunsichert begegnet. Manche hätten sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen in der Hoffnung, so mutmaßte Karola, sie würde dann Abstand nehmen von dem, was ihr gutes Recht wäre, wenn sie Eigentümerin werden würde.
Karola fand schließlich eine Wohnung. Ein Rentnerehepaar Jahrgang 1950 wohnte darin. »Da kommen wir uns sicher nicht in die Quere«, lachte sie, als sie mir davon berichtete. Man könne ja doch nie wissen, vielleicht müsse sie im Alter selbst mal da einziehen. Dann verstummte sie. »Solche Gedanken, dass man den Tod von Leuten einberechnet in die Abwägung. Nicht schön.«
Karolas Geschichte ist kein Einzelfall. Immer wieder habe ich von Leuten ihrer Generation gehört, die von ihrer Rente nicht viel zu erwarten haben, ein wenig erben oder angespart haben und nun überlegen, wie sie es so parken, dass es nicht weniger wird, dass es zumindest sicher liegt. Im besten Falle soll es sogar mehr werden, eine kleine Rendite abwerfen. Es gibt derzeit viele Möglichkeiten, sein Geld »anzulegen«, wobei oft undurchsichtig bleibt, woher die erhoffte Geldvermehrung stammt. Zwar heißt es in der Werbung »Geld arbeitet« oder »Lassen Sie Ihr Geld arbeiten«, aber das sind typische Mystifizierungen der vermeintlich aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft. Geld arbeitet nicht – Menschen arbeiten.
Im Fall der Vermietung ist es ziemlich deutlich, woher die Vermehrung des eingesetzten Kapitals kommt. Hier wird das Lebenseinkommen der einen, der Mieterinnen, dadurch weniger, dass es das Lebenseinkommen der anderen, der Vermieter, mehrt. Das Verhältnis zwischen Karola und ihren betagten Mietern ist rein instrumentell. Nur das partikulare Interesse, der Eigennutz von Karola, hat sie mit dem Ehepaar zusammengebracht.
Sie wären sich sonst wahrscheinlich nie begegnet. Es ist eine sachliche Beziehung, eine, die über Vertrag und Geld abläuft, bei der Gefühle keinen Platz haben (sollen). Es ist Privatsache jeder Einzelnen, ob in diese rein sachlichen Beziehungen Empathie hineinspielt (Karolas schlechtes Gewissen) oder ob man die Achseln zuckt und sagt, so ist sie nun mal, diese Welt, das ist nicht mein Problem.
Es ist der Persönlichkeit des Einzelnen überlassen, ob er sich in solchen Situationen und Strukturen teilnahmsvoll verhält oder ob er tut, was ihm nahegelegt wird: gleichgültig auf Kosten anderer leben, angesichts der falschen Annahme, mit ihm habe all dies nichts zu tun.
Aber diese Welt ist nicht einfach, wie sie halt ist, natürlich und ewig. Sie ist geworden und sie wird gemacht. Von uns allen. Die Naturalisierung der herrschenden Verhältnisse (»das ist doch ganz natürlich, das war doch schon immer so«) ist allerdings eines der großen Hindernisse für gesellschaftliche Veränderung. Das zeigt sich besonders plastisch an der Ideologie des Privateigentums. Und um sie und ihre Auswirkungen soll es im vorliegenden Buch gehen, das eine überarbeitete und stark erweiterte Neuauflage meines im Oktober 2019 erschienenen Buchs »Keine Enteignung ist auch keine Lösung« ist.
Als das Buch vor etwas mehr als vier Jahren erschien, hatte die Berliner Bürgerinitiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen « gerade die erste Hürde des von ihr organisierten Volksbegehrens genommen: 77 100 Unterschriften hatte sie gesammelt, um überhaupt einen Volksentscheid beantragen zu können. Weit mehr, als vorgeschrieben war. Die Bürgerinnen und Bürger Berlins sollten darüber entscheiden können, ob der Senat ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen erarbeiten soll. Im Fokus standen Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen allein in Berlin besitzen und sie vermieten, um damit Geld zu verdienen. Dazu gehört auch der Konzern Deutsche Wohnen mit mehr als 100 000 Wohnungen in der Hauptstadt. Von ihm lieh sich die Kampagne ihren Namen. Das Geschäftsmodell der Immobilienunternehmen war in die Kritik geraten, weil es als einer der Treiber der exorbitant gestiegenen Mieten galt. Mit einem Schlag hatte die Kampagne mit dem Ruf nach Enteignung die Eigentumsfrage auf die Tagesordnung gesetzt und eine hitzige Debatte ausgelöst. Das war einer der Anlässe, warum ich damals dieses Buch schrieb. Ich wollte mir genauer anschauen, was die Kritiker der Enteignungskampagne stillschweigend voraussetzten, wenn sie sich darüber empörten. Seither ist vieles passiert, so viel, dass eine Neuauflage des nun schon länger vergriffenen Buchs über eine bloße Aktualisierung der Fakten hinausgehen sollte.
Laut und schrill waren seinerzeit jene Stimmen, die die geltende Ordnung des Privateigentums in Gefahr sahen und zu ihrer Verteidigung aufriefen. Schließlich beruhe, so die Argumentation, doch auf ihr der materielle Reichtum der Gesellschaft. Sie wiederholten also einmal mehr ein altes Versprechen: Privateigentum, so lautet es kurz gefasst, gewähre im Gegensatz zu gemeinschaftlichen Formen des Eigentums größere Freiheit, mehr Autonomie des Individuums; das befördere den Anreiz, aus den gegebenen knappen Ressourcen etwas zu machen; es sei daher effizienter und führe zu Wachstum und Wohlstand, was der ganzen Gesellschaft zugutekomme.
Das Versprechen des Privateigentums ist allerdings vergiftet, denn der erzielte Wohlstand ist höchst ungleich verteilt und das Wachstum bringt den Planeten Erde mittlerweile an für Menschen existenzielle Grenzen. Nichtsdestotrotz gilt das Versprechen des Privateigentums als unumstößlich und allgemein gültig; es ist zu einem der hartnäckigsten und am weitesten verbreiteten Mythen unserer Zeit geronnen; es trifft im Alltagserleben auf eine gewisse Plausibilität, was seine Stärke fördert; es stößt kaum auf entkräftende Gegenargumente; es hat eine ideologische Funktion – und das nicht zufällig –, seit es die kapitalistische Produktionsweise gibt, denn es ist, könnte man sagen, ihr intellektuelles Schmiermittel.
Seit wann aber gibt es dieses Versprechen und woher kommt es? Was genau verspricht es? Was löst es ein, was nicht und warum tut es das nicht? Was ist mit Privateigentum gemeint? Von welcher Effizienz ist die Rede? Welche Freiheit beinhaltet das Versprechen, welche nicht? Warum ist diese Erzählung so wirkmächtig? Kurz: Was ist dran an dem Versprechen des Privateigentums? Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, so lautete mein damaliges Argument, kann man über Enteignung sinnvoll reden. Welche Dimensionen hat Enteignung? Wer enteignet wen? Und vor allem: Warum ist vor dem Hintergrund der skizzierten Probleme keine Enteignung auch keine Lösung?
Viele, die zu den Vorstellungen meines Buches gekommen sind, waren dem Titel gegenüber skeptisch eingestellt oder standen ihm ablehnend gegenüber. Enteignung? Damit kann man doch niemanden gewinnen. Einer der Veranstalter sagte mir, es wären bestimmt mehr Leute gekommen, hätten wir einen anderen Titel gewählt. Dieser Haltung begegnete ich vor allem in den kleineren Ortschaften, außerhalb der urbanen Zentren. Enteignung schreckt ab, vor allem im Osten, so sagte man mir. Dabei geht es gar nicht um Enteignung im streng juristischen Sinne, sondern um Vergesellschaftung. Enteignung ist eine staatliche Handhabe, die im Grundgesetz (GG) in Artikel 14 Absatz 3 vorgesehen ist und regelmäßig zur Anwendung kommt, beispielsweise beim Bau von Autobahnen oder beim Abbau von Kohlevorkommen, wo Landeigentümer wenn nötig enteignet werden.2 Dagegen findet sich Vergesellschaftung im Artikel 15 GG als eine politische Maßnahme, die zwar seit Geltung des Grundgesetzes 1949 als Möglichkeit verankert ist, aber noch nie angewandt wurde. Die Ausführungen zu diesem Grundgesetzartikel sind angesichts seiner politischen Tragweite, so Verfassungskommentatoren, recht »spärlich«, da er gerade einmal zwei Sätze umfasst: »Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.« Grob gesprochen geht es hier um die Umwandlung privater, eigennütziger Verfügungsmacht über die Mittel des Lebens in eine öffentliche und gemeinnützige Verfügungsmacht. Eine in der Tat weitreichende Norm.
Die Initiatorinnen und Initiatoren der Kampagne »Deutsche Wohnen & Co enteignen« zielten nicht von Anfang an auf Vergesellschaftung oder Sozialisierung (was synonym zu verstehen ist). Sie entschieden sich zunächst spontan für den emotional aufgeladenen Begriff Enteignung. Denn die Mieterinnen und Mieter waren wütend. Sie fühlten sich den großen Immobilienkonzernen ausgeliefert. Nicht nur, dass die Mieten erhöht wurden und das sowieso sinkende oder geringe Einkommen auffraßen, zugleich vernachlässigten diese großen Vermieter Maßnahmen zur Instandhaltung und waren, so die oft gehörte Klage, nicht erreichbar, wenn mal die Heizung ausfiel oder andere Mängel das Wohnen erschwerten. Genau weil die Forderung »enteignen« polarisiert, hielt man diesen Begriff für zielführend. Er sollte mobilisieren, der Wut und der Ohnmacht ein Ventil geben. Erst später, als sich die Aktivistinnen und Aktivisten aufmachten, zu prüfen, auf welcher juristischen Grundlage ihre Forderung umgesetzt werden könnte, stießen sie auf die Möglichkeit nach dem besagten Artikel 15 im Grundgesetz.
Nachdem die Initiative in einem zweiten Schritt 359 063 Unterschriften bis Juni 2020 für die Einleitung eines Volksentscheids gesammelt hatte (wieder weit mehr als erforderlich), war klar, dass ein Referendum kommen würde. Angesichts der damals bevorstehenden Landtagswahl erklärte die Berliner Spitzenkandidatin der SPD Franziska Giffey: »Für mich ist das Thema Enteignung schon eine rote Linie.« Die aus dem Osten stammende Politikerin gab zu bedenken, sie selbst habe gesehen, was Enteignung mit Menschen mache. In einer Stadt, so fügte sie mit betroffener Miene hinzu, die solch ein Signal sende, wolle sie nicht leben. Auch Liberale und Konservative machten mobil und warfen der Kampagne vor, sie würde die DDR oder wahlweise den Gulag zurückhaben wollen. All diese Polemik verfing nicht. In dem parallel zur Wahl zum Abgeordnetenhaus durchgeführten Referendum sprachen sich über eine Million Menschen für die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne aus (59,1 Prozent der gültigen Stimmen). Giffey wurde Regierende Bürgermeisterin und der rot-grün-rote Senat berief – in Teilen eher widerwillig als erfreut – eine Expertenrunde ein: die »Kommission zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände«. Ein ganzes Jahr sollten 13 Fachleute prüfen, ob und wie eine von den Bürgerinnen und Bürgern gewünschte Vergesellschaftung verfassungskonform umzusetzen wäre. In der politisch paritätisch besetzten Kommission saßen elf Professorinnen und Professoren der Disziplinen Infrastrukturwirtschaft, Politik, Öffentliches Recht und Europarecht, Geografische Stadtforschung, Staats- und Verwaltungsrecht, Arbeits- und Sozialrecht, Neuere Rechtsgeschichte, ein ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht sowie die Vorstandsvorsitzende einer Bank.
Irgendwann haben dann auch die Medien verstanden, dass es juristisch gar nicht um Enteignung ging, sondern um einen ganz anderen Sachverhalt. Der Jurist Georg Freiß publizierte im Januar 2023 schließlich einen Text im renommierten Portal »Verfassungsblog« mit der programmatischen Überschrift »Eigentumsverhältnisse sind antastbar«. Er diskutierte darin eine weitere Initiative namens »RWE & Co enteignen«, die die Demokratisierung des Energiesektors anstrebt. Auch diese Kampagne bezieht sich auf Artikel 15 GG. Seit »Deutsche Wohnen & Co enteignen« den Begriff Vergesellschaftung auf die öffentliche Agenda gesetzt habe, so schrieb Freiß, nehme die Vergesellschaftungsidee an Fahrt auf. Freiß zufolge sei eine gerechte und nachhaltige Stromversorgung gemeinwirtschaftlich zu gestalten, was durchaus von der Verfassung gedeckt sei: »Die RWE Power AG ist somit ein in allen Belangen geeignetes Sozialisierungsobjekt.« Und noch eine Initiative ist öffentlichkeitswirksam in Erscheinung getreten: »Hamburg enteignet«. Auch hier sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt über die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen abstimmen können.
Im Februar 2023 mussten die Berlinerinnen und Berliner erneut an die Urne. Wegen zu vieler Pannen bei der vorherigen Wahl zum Abgeordnetenhaus musste sie wiederholt werden. Die Abstimmung zur Vergesellschaftung war davon allerdings nicht betroffen. Die Expertenkommission setzte ihre Arbeit fort, lud Fachleute ein, stellte die Vorträge und Diskussionsprotokolle online, die ernsthafte Debatten dokumentierten, oft trockene Materie, juristisches Tauziehen zwischen sich widerstreitenden verfassungsrechtlichen Auslegungen.
Durch die Neuwahl kam eine Koalition aus CDU und SPD an die Regierung, die, so die Befürchtung bei vielen Aktivistinnen und Sympathisanten der Kampagne, das Aus für das Vergesellschaftungsprojekt bedeuten würde. Der schwarz-rote Koalitionsvertrag beinhaltete dann aber einen Passus, der für Überraschung und Skepsis zugleich sorgte: Falls die Expertenkommission eine Empfehlung zur Vergesellschaftung abgebe, wolle die Koalition ein »Vergesellschaftungsrahmengesetz« verabschieden, so stand es da geschrieben. Man wolle Kriterien für eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 GG finden, und zwar nicht nur für Wohnen, sondern auch in den »Geschäftsfeldern der Daseinsvorsorge«, wie zum Beispiel Wasser und Energie. Die FDP empörte sich daraufhin erwartungsgemäß über vermeintliche »Massenenteignungen«, während die Aktivistinnen ebenfalls Kritik übten und von einem »wirkungslosen Rahmengesetz zur Verschleppung« sprachen. Symbolpolitik sei dies. Man traute der Koalition nicht. Nur die Vorsitzende der Vergesellschaftungskommission, Herta Däubler-Gmelin, zeigte sich zufrieden und begrüßte die Ankündigung im Koalitionsvertrag.
Der Artikel 15, so formulierte es ein Verfassungsrechtler in kritischer Absicht im Kommentar zum Grundgesetz mit Blick auf die aktuellen Debatten, sei aus dem Dornröschenschlaf gerissen worden.10 Die Idee der Vergesellschaftung oder Sozialisierung der Produktionsmittel war die Kernforderung der Arbeiterbewegung gewesen, vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis in die Weimarer Republik hinein. Die Diskussionen darum, die Streiks dafür, die Versuche, die Forderung Realität werden zu lassen, spitzten sich nach dem Ersten Weltkrieg und der gescheiterten Novemberrevolution zu. Das Anliegen fand Eingang in die Weimarer Reichsverfassung, blieb aber ebenso ohne Anwendung wie nach der Aufnahme ins Grundgesetz der Bonner Republik. Diese Sachverhalte, auf die noch näher einzugehen sein wird, machen deutlich, dass die Arbeiterbewegung nicht allein für die Demokratie in der politischen Sphäre gekämpft hat, sondern auch für Demokratie in der Sphäre der Wirtschaft. Ein Aspekt, der regelmäßig untergeht bei offiziellen Demokratiefeiern und entsprechenden Gedenktagen.
Man kann das Wiedererwachen der Vergesellschaftungsidee im 21. Jahrhundert lesen als Reaktion auf 30 Jahre forcierte Privatisierung, auf den Siegeszug einer Ideologie, die den Menschen die Ordnung des Privateigentums ungeachtet ihrer destruktiven Auswirkungen für die beste aller möglichen Welten verkauft. Schon die verfassungsmäßige Möglichkeit der Vergesellschaftung war weitgehend in Vergessenheit geraten. Nur die FDP erinnerte immer mal wieder daran, indem sie in unregelmäßigen Abständen die Streichung des Artikels 15 aus dem Grundgesetz beantragte. Vier Monate nach der Bekanntgabe des schwarz-roten Koalitionsvertrags in Berlin überreichte Herta Däubler-Gmelin am 28. Juni 2023 im Roten Rathaus dem amtierenden Regierenden Bürgermeister den Kommissionsbericht. Der Inhalt war eine Überraschung, mehr noch: ein Paukenschlag. Denn er enthielt eine klare Empfehlung zur Vergesellschaftung. Zumindest konnte man das so lesen.
Eine der zentralen Aussagen des Berichts war, dass man mit einer Vergesellschaftung des von den großen Immobilienkonzernen gehaltenen Wohneigentums die Explosion der Mieten in Berlin stoppen könne. Sofern das Vorhaben wie geschätzt knapp 222 000 Wohnungen umfasse, beträfe die Vergesellschaftung rund 13,5 Prozent der gut 1,6 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Es sei angesichts dieser Größenordnung nicht unwahrscheinlich, dass das Vorhaben – jedenfalls mittelfristig – auch im nicht vergesellschafteten Bestand mietpreisdämpfende Effekte zeitigen würde. Der Grund: Die günstigeren Mieten im vergesellschafteten Bestand würden in die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einfließen. Die Mieten würden im vergesellschafteten Bestand schon deshalb sinken, weil sie nicht mehr der Vermehrung von Aktionärskapital dienen müssten. Eine Anstalt öffentlichen Rechts oder ein anderer Träger des gemeinwirtschaftlich zu bewirtschaftenden Eigentums wäre als Vermieterin dauerhaft dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Anteil der Miete entfiele, der bei gewinnorientierten Wohnungsunternehmen die angestrebte private Rendite ausmache.
Da laut Kommission gegenwärtig keine Wege ersichtlich seien, die eine vergleichbare Wirkung hätten, wird die Überführung der Immobilienbestände der Großkonzerne in Gemeineigentum von den meisten Kommissionsmitgliedern als geradezu erforderlich betrachtet. Nur drei Kommissionsmitglieder äußerten Zweifel an der Verhältnismäßigkeit einer Vergesellschaftung und haben ein Sondervotum abgegeben.
Auch was das Thema Neubau angeht, rechnete die Kommission mit einem gebetsmühlenartig vorgetragenen Mythos ab: Eine »verstärkte Neubautätigkeit stellt keine Alternative dar, um das Ziel der Verbesserung der dauerhaften Versorgung mit bezahlbaren Wohnungen zu erreichen«. Das heißt nicht, dass die Kommission Neubau für unnötig hielte, im Gegenteil, aber auch hier sieht sie in der Vergesellschaftung eine Möglichkeit, Nachverdichtung und Aufstockung im betroffenen Bestand, aber perspektivisch auch bezahlbaren Neubau zu erleichtern.
Auch wenn der Bericht der Kommission von der gesellschaftlichen Linken bislang kaum aufgegriffen worden ist: das Thema Vergesellschaftung könnte einer der Schlüssel nicht nur zur Überwindung der Wohnungskrise sein. Dafür ist es sinnvoll, sich noch einmal die Tradition der Vergesellschaftungsforderung zu vergegenwärtigen und im Anschluss daran zu fragen, welches Potenzial in den neuerlichen Kämpfen für Vergesellschaftung liegen könnte, und zwar im Hinblick auf eine emanzipatorische postkapitalistische Gesellschaft.
Für die vorliegende Neuauflage des Buches wurden einige Passagen korrigiert, andere stark erweitert und um vertiefende Argumentation ergänzt. Neu ist die Auseinandersetzung mit Vergesellschaftung als theoretischem Konzept vor dem Hintergrund der historischen Vergesellschaftungsdebatte. Bis auf wenige Korrekturen nahezu unverändert geblieben sind die Abschnitte über das Versprechen des Privateigentums und die Spuren des Eigentums. Diese Teile haben an Aktualität nichts eingebüßt, denn die herrschende Ideologie des Privateigentums verschließt nach wie vor den Raum, in dem Alternativen nicht nur denkbar, sondern auch hegemonial werden könnten.