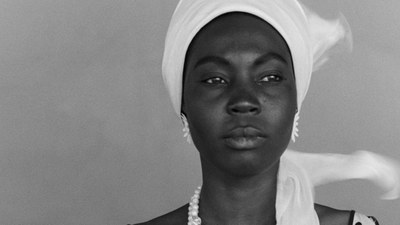Die Sektion zeigt eine Auswahl der spannendsten Werke von Filmschaffenden am Anfang ihrer Laufbahn: Das Programm ist vielfältig und offen für unterschiedliche Perspektiven, Genres und Stile. Die Werke können ambivalent sein oder geradlinig, mit Versatzstücken aus dem Genrekino arbeiten, realistisch oder fantastisch angelegt sein, dem klassischen Autorenfilm huldigen oder hybride Formen erkunden. Allen gemein ist: Sie lassen uns heute schon einen Blick in das Kino von morgen werfen.
Der internationale Wettbewerb ist mit seinen 16 fiktionalen Langfilmen Kern des Festivals und schreibt die reiche Tradition des IFFMH als Bühne für herausragende Regietalente fort.
Geografische Vielfalt
Bei aller geografischen Vielfalt sind manche Länder 2024 besonders stark vertreten. Weniger überraschen mag, dass die USA gleich drei Independent-Produktionen ins Rennen um die Preise schicken. Zwei davon sind mitreißende Thriller, Genrefilme, aber das ist angesichts ihrer Eigenständigkeit fast schon alles, was sie verbindet. Der dritte hingegen ist ein anrührendes Drama über eine demente Frau. Dann sind je zwei Filme aus Indien, Georgien und Marokko dabei. Die indischen Produktionen, beide von Regisseurinnen, bieten ganz unterschiedliche Geschichten über Frauen, aber in bestimmten Punkten lassen sie auch bemerkenswerte Parallelen erkennen.
Die Vielfalt des diesjährigen Wettbewerbs ist aber noch größer: Sie reicht von einer romantischen Lovestory aus China über ein ebenso kritisches wie atmosphärisches Gesellschaftsporträt des Iran, eine Geschichte der Gewalt aus Irland, eine Künstlerin am biografischen Scheideweg in Rumänien, das harte Los von Frauen im brasilianischen Amazonasgebiet bis hin zu politisch und stilistisch eindrucksvollem und eigenständig-frischem Kino aus der Dominikanischen Republik.
Kritischer Blick auf die Welt
Eine Vielzahl der Werke analysieren und diskursivieren gesellschaftliche Schieflagen und prangern soziale oder politische Missstände an. ›Girls will be Girls‹ und ›Santosh‹ der indischen Regisseurinnen Shuchi Talati und Sandhya Suri hinterfragen Kastensystem, Patriarchat und korrupte Strukturen. Ebenfalls aus weiblicher Perspektive beschwören Johanné Gómez Terreros ›Sugar Island‹ aus der Dominikanischen Republik und ›Manas‹ der Brasilianerin Marianne Brennand die Selbstermächtigung von Frauen und die Überwindung arbeitsrechtlicher Ungerechtigkeiten.
Vor dem Hintergrund einer visuell spektakulären romantischen Lovestory hinterfragt Regisseurin Xin Huo in ›Bound in Heaven‹ die Vereinsamung in Chinas gegenwärtiger Gesellschaft. Während Sarra Tsorakidis mit dem faszinierend streng komponierten ›Ink Wash‹ über eine Künstlerin am biografischen Scheideweg in Rumänien die politisch gefärbten Frauenporträts ergänzt, zählt Shahab Fotouhis iranischer ›Boomerang‹ zu den ebenso kritischen wie atmosphärischen Gesellschaftsporträts.
Stilistische Vielfalt
Die amerikanischen Beiträge reichen vom Paranoia-Kino in ›Gazer‹ über die Midnight Madness bei ›Dead Mail‹ bis hin zum klassischen Drama in Sarah Friedlands ›Familiar Touch‹. In ›Bring them down‹, dem Regiedebüt des Iren Christopher Andrews mit Barry Keoghan und Christopher Abbott, entlädt sich auf der hochgebirgigen Schafsweide eine generationenübergreifende Angst und Wut. Das hat metaphorische, epochale Wucht! Und bildet eine Klammer zum diesjährigen Abschlussfilm, Sophie Deraspes frankokanadische Aussteigergeschichte ›Shepherds‹, in der das Schäferidyll beschworen wird.
Das lässt schon erahnen: Nicht nur geografisch, sondern auch stilistisch ist die Vielfalt des Wettbewerbs bemerkenswert. Sie umfasst kleine Vignetten, große Erzählungen, körnige Bilder, aufwendige Produktionen und mit geringsten Mitteln erschaffenes, authentisches Kino umfasst, vermitteln die Filme jeder für sich einen ganz neuen Blick auf die Welt und das, was Kino sein kann.