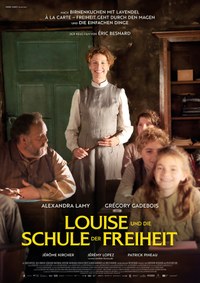Sie bezeichnen Heldin als eine Liebeserklärung ans Pflegepersonal. Was war der Auslöser für dieses Projekt, und was war Ihnen bei der Recherche und den Dreharbeiten besonders wichtig?
Das Thema Pflege beschäftigt mich schon viele Jahre. Ich habe lange mit einer Pflegefachfrau zusammengelebt und jeden Tag mitbekommen, was sie auf der Arbeit erlebt, das Schöne und das Harte, welches vor allem auch mit den Bedingungen zu tun hatte, die zunehmend schlechter wurden. So musste sie in immer kürzerer Zeit immer mehr leisten und das Menschliche blieb dabei mehr und mehr auf der Strecke, was sie zunehmend belastet hat. Während Covid ist der Beruf dann sehr ins Rampenlicht gerutscht. Die Pflegenden wurden auf den Balkonen beklatscht und der Beruf war als „systemrelevant“ plötzlich in aller Bewusstsein. Die Pflege ist jedoch nicht nur während einer Pandemie „systemrelevant“. Meiner Meinung nach sollte dieser Beruf zu einem der höchst angesehensten und respektiertesten in unsere Gesellschaft gehören. Es ist nicht nur ein technisch hoch anspruchsvoller Job, sondern auch menschlich und psychologisch. Pflegende kümmern sich um uns, wenn wir krank und alt sind, wenn wir am verletzlichsten, abhängigsten und bedürftigsten sind. Sie tragen tagtäglich eine enorme Verantwortung. Deswegen wollte ich einen Film machen, der diesen Beruf feiert. Der Drehbucharbeit ging eine lange Recherche voraus. Ich habe versucht, mir ein umfassendes Bild über die Situation in der Pflege zu beschaffen und bei der Umsetzung stand Genauigkeit an oberster Stelle. Es ging schliesslich um die Darstellung eines Berufes, wie er sonst nicht gezeigt wird, und das Drama des Films entwickelt sich aus der genauen Beobachtung der Abläufe auf einer normalen Schicht.
In Traumland die im Rotlichtmilieu arbeitende Bulgarin Mia, in Die göttliche Ordnung der Kampf der jungen Hausfrau Nora ums Schweizer Frauenstimmrecht und in Heldin, die Pflegefachfrau Floria und deren Spätschicht auf einer unterbesetzten Pflegestation: Sie greifen in Ihren Filmen gesellschaftspolitische Themen mit Fokus auf Frauenfiguren auf. Lassen sich solche Geschichten besser aus weiblicher Perspektive erzählen?
Solche Geschichten lassen sich aus jeder Perspektive gut erzählen! Denn es geht dabei um Ungerechtigkeit, und das ist sicher ein Thema, das mich als Filmemacherin und Mensch sehr beschäftigt. Man muss sich nur ein paar Statistiken anschauen und kann erkennen, dass wir nach wie vor in einer von Sexismus geprägten Welt leben. Das ist nicht einfach meine persönliche Wahrnehmung, sondern das sind die harten Fakten. Und gerade scheint sich das Rad auch wieder zurückzudrehen.
Der Pflegeberuf ist traditionell und historisch ein Frauenberuf, und deswegen ist er auch schlechter bezahlt als vergleichbare Berufe, in denen vor allem Männer arbeiten. Aber abgesehen von der Bezahlung hat der Beruf in der Gesellschaft auch nicht die Anerkennung und den Respekt, den er verdient. Hohe Anerkennung wird oft viel mehr den Ärzten entgegen gebracht, obwohl ein grosser Teil der Verantwortung für die Patient:innen bei der Pflege liegt.
Warum war die deutsche Schauspielerin Leonie Benesch die Richtige für die Rolle der Floria?
Ich suchte eine Schauspielerin, die absolut natürlich wirkt, eine Leichtigkeit hat, und die gleichzeitig mit tänzerischer Eleganz und Selbstverständlichkeit die ganzen Pflegehandlungen ausführen kann. So dass es wirkt, als würde sie diesen Beruf schon 10 Jahre lang ausüben. Weil ich in den USA lebe, fand das Casting mit Leonie über Zoom statt. Schon als sie ins Bild trat und den erste Satz als Floria sprach, wusste ich, dass sie es ist. Es war ein magischer Moment, denn die Figur, die so lange in meinem Kopf lebte, war durch Leonie augenblicklich komplett und perfekt da.
Für Heldin arbeiteten Sie bereits zum dritten Mal mit der preisgekrönten Kamerafrau Judith Kaufmann zusammen. Was zeichnet Ihre Zusammenarbeit aus?
Mit Judith habe ich eine sehr innige kreative Partnerschaft und Freundschaft. Wir brennen beide für unsere Arbeit, die sehr eng mit unserem Leben und Sein in der Welt verbunden ist. Sie ist meist schon ab der ersten Idee für ein Projekt an meiner Seite und ich tausche mich mit ihr auch in der Drehbuchentwicklungsphase intensiv aus. Judith ist durch und durch eine Künstlerin und der Dialog mit ihr ist immer zutiefst inhaltlich. Sie ist eine Kamerafrau, die genauso wie ich in meiner Rolle als Autorin und Regisseurin, immer nach der Essenz eines Stoffes sucht. In der Vorbereitungszeit reden wir viel über die Emotionalität des Themas, die Figuren, Stimmungen und tasten uns so langsam an den Film heran. Am Set ist sie der Fels in der Brandung, sie bringt eine enorme Erfahrung mit, von der ich extrem profitiere und immer viel lerne. Sie ist minuziös vorbereitet, aber trotzdem immer bereit alles über den Haufen zu werfen, um etwas Neues auszuprobieren. Und sie geht immer noch einen Schritt weiter und hört nie auf zu suchen – all das macht unsere Zusammenarbeit zu einem Geschenk.
Die Zukunft des Pflegefachpersonals ist düster: Bis 2040 werden in der Schweiz 40.000 Pflegefachkräfte fehlen. Die WHO schätzt, dass bereits bis 2030 weltweit rund 13 Millionen Pflegende fehlen werden. Ihr Film zeigt eindrücklich, was der abstrakte Begriff «Personalmangel» für die Pflegenden und die Patient:innen konkret bedeutet. Welche Publikumsreaktionen auf Heldin erhoffen Sie sich?
Ich hoffe, dass der Film einerseits gute Unterhaltung bietet, weil man auf eine aufwühlende Achterbahnfahrt mitgenommen wird. Andererseits aber auch erfährt, was es bedeutet, diesen Beruf auszuüben. Für viele Menschen steht eine Pflegefachperson am Anfang ihres Lebens, aber auch am Ende. Sie sind nicht selten die ersten und letzten die uns berühren. Wir begegnen ihnen meist, wenn unser eigenes Leben oder das Leben eines geliebten Menschen in einer Krisensituation ist. Oft ist dies ein beängstigender Ausnahmezustand, weil es um Leben und Tod geht. Ich möchte die Zuschauer:innen daran erinnern, wie dankbar wir alle sein können, dass uns in diesem Moment ein professioneller, empathischer Mensch zur Seite steht. Wir sollten uns bewusst sein, dass deren Kampf für bessere Arbeitsbedingungen unser aller Kampf sein sollte!
Heldin lässt sein Publikum unmittelbar und atemlos den Alltag von Floria miterleben und versetzt die Zuschauenden mit Florias Rennen gegen die Zeit richtiggehend in körperliche Unruhe. Warum war es Ihnen wichtig, Heldin als packenden, äusserst spannenden Spielfilm zu erzählen und wie entstand die Idee für diese Art der Inszenierung?
Ich habe lange nach einer Herangehensweise an dieses Thema gesucht. Im Zuge meiner Recherchen habe ich das Buch von der deutschen Pflegefachkraft Madeline Calvelage «Unser Beruf ist nicht das Problem – es sind die Umstände» gelesen. Dabei beschreibt sie minutiös eine gewöhnliche Spätschicht. Das Buch hat mich komplett gepackt. Schon nach fünf Minuten hatte ich Herzrasen und dachte, das liest sich so spannend wie ein Thriller, obwohl es ja nur ganz normaler Pflegealltag ist. So kam die Idee einen Film zu machen, der eine einzige Arbeitsschicht aus der Perspektive einer Pflegefachperson erzählt, und der einen auf eine geradezu physische Art packt. Es war ein längerer Prozess alle Figuren und deren Krankheitsbilder zu entwickeln und dabei eine Schicht zu erfinden, die zu einer möglichst spannenden Eskalationsdramaturgie führt. In vieler Hinsicht war das Schreiben des Drehbuches eine neue Herausforderung, weil es eine ungewöhnliche Struktur hat. Auch für die Umsetzung haben wir uns sehr bewusst für diese konsequente Perspektive entschieden und uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir den Stoff so erzählen können, dass man beim Zusehen das Gefühl hat, man ist selber die Pflegefachkraft.
Die Nebenrollen sind divers besetzt und es lassen sich einige neue Schauspieltalente entdecken. Was war Ihnen bei der Besetzung der Nebenrollen wichtig?
Die Diversität kommt daher, dass wir in einer diversen Gesellschaft leben und eine Abteilung im Spital spiegelt dies. Krankheit und Tod ist etwas, was jeden Menschen betreffen kann, es ist etwas das uns alle am Ende gleich macht.
Wir haben ein sehr aufwändiges Casting durchgeführt. Mir war wichtig, dass man die meisten Darsteller:innen nicht sofort aus anderen Filmen oder Serien erkennt, deswegen sind einige Darsteller:innen sogar Laien oder haben mehrheitlich Theater gespielt. Einige Pflegende im Film und das Reanimationsteam sind echte Pflegefachkräfte und Ärzte.
Der grösste Teil der Dreharbeiten fand in einem leerstehenden Spital statt. Was waren diesbezüglich die Herausforderungen?
Wir mussten das ausgehölte Spital wieder voll ausstatten. Dabei hat uns Nadja Habicht, unsere Fachberaterin, die auch Leonie gecoached hat, geholfen. Ohne sie hätten wir das gar nicht geschafft, weil ja niemand von uns das Fachwissen darüber hat, was es alles braucht. Nadja hatte auch die nötigen Kontakte. Wir mussten z.B. für unsere Apotheke hunderte von leeren Medikamentenschachteln haben. Befreundete Pflegefachkräfte von Nadja haben die für uns gesammelt. Das Spital musste jedoch auch visuell etwas hergeben, ohne artifiziell zu wirken; ein gestalteter Ort, der nicht gestaltet wirkt, das war die Herausforderung für das Szenenbild.