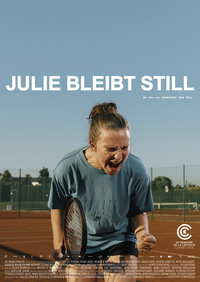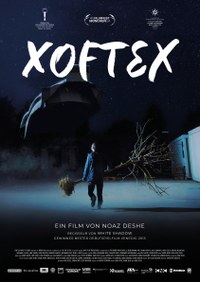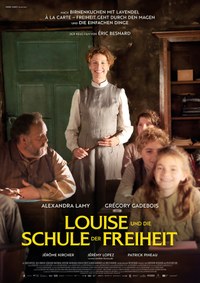Gerade die Nachwendezeit ist eine Phase, die in Ost und West kaum unterschiedlicher sein könnte. Obwohl das Land offiziell vereint war, erlebte die eine Seite einen tiefen Bruch und eine Art Migrationserfahrung im eigenen Land, während die anderen ihr gewohntes Leben weiterleben konnten. Für die junge Generation bedeutete das, mit Eltern aufzuwachsen, die keine Zeit hatten, weil sie zu sehr damit beschäftigt waren, sich in dem neuen Leben zurechtzufinden. Auf mehreren Ebenen. Politisch, sozial, kulturell und finanziell.
Bis heute ist das vielen nicht bewusst, weil ostdeutsche Themen in Medien und Kultur keine große Lobby erfahren und nicht zum Selbstverständnis deutscher Geschichte gehören. Die ostdeutsche Erfahrung scheint noch immer kaum Wert, repräsentiert zu werden, obwohl sie für das Verständnis rechter Tendenzen im Osten unumgänglich ist. Doch es fehlen, besonders im Film, die Geschichten über den Osten, erzählt von Menschen aus dem Osten. Das Ostdeutsche an meinem Film ist der innere Blick zu den Figuren. Hinter den Stereotypen stecken komplexe Biografien und individuelle Schicksale.
Die AfD und Pegida sind auch, wenn nicht vor allem, Emotionsbewegungen. Die Fremdenfeindlichkeit ein Ausdruck von Systemkritik und bei den jungen Menschen auch gerne ein gewollter Gegenentwurf zum selbstverständlichen Antifaschismus ihrer Eltern – den Abgehängten, den Nie-Angekommenen. Mir ist es ein großes Bedürfnis, dass dieses Nicht-Gehörtwerden ostdeutscher Geschichten nicht länger im fremdenfeindlichen Gedankengut endet, sondern ein Diskurs auf Augenhöhe angeregt wird.
Sehr besonders für mich ist, dass der Roman, wie auch der Film, erst um die Jahrtausendwende beginnt und dennoch die gleichen Themen verhandelt wie bereits zehn Jahre zuvor. Wenn wenig Neues entsteht, wird immer die Perspektive fehlen, wird automatisch zurückgeschaut und sich mit der Vergangenheit identifiziert. Wenigstens dies scheint ein bisschen Halt zu geben.
– Constanze Klaue, Regisseurin