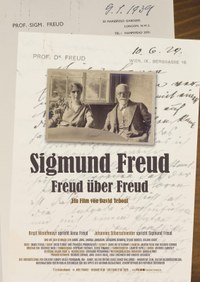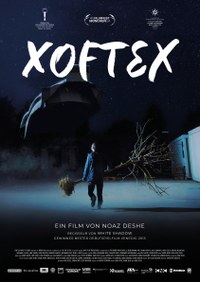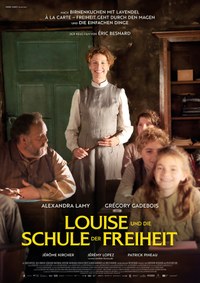Der Film ist wie ein Triptychon zusammengestellt, Geburt, Traum und Zusammenbruch. Sie machen ein Porträt von Freud und haben entschieden, sich auf Texte und Korrespondenzen aus jener Zeit, anstatt auf Kommentare zu konzentrieren. Warum?
Als ich einen Film über das Leben und Denken von Sigmund Freud drehen wollte, war es für mich wichtiger, dass man seine Sprache und seine Stimme, den Denker sowie seine Beziehung zu seiner Tochter Anna spürt. Indem ich Freud, dem Denker, und nicht der Psychoanalyse einen zentralen Platz gebe, hoffe ich als Regisseur einen authentischen Freud’schen Film gedreht zu haben, und zwar ohne Kommentare oder Erklärungen von Experten. Eine bewusste Entscheidung, sowohl aus dokumentarischer als auch filmischer Sicht. Die Psychoanalyse steht zwar nicht im Mittelpunkt des Films, ich stütze mich aber auf den Prozess der freien Assoziation, einem Bestandteil der psychoanalytischen Sitzung, um in Freuds Leben und Werk einzutauchen. Die Träume von Freud sehen und hören, um sein Denken, sein Privatleben, seine Beziehung zu seiner Tochter Anna zu verstehen. Die Träume stehen oft in einem historischen und politischen Kontext. Dies hat dem Film eine historische Dimension verliehen, denkt man nur an den Untergang des Österreich-Ungarischen Reichs, das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Konsequenzen des Nationalsozialismus.
Anna Freud scheint eine Schlüsselfigur des Films zu sein. Wie ist sie zu dieser Figur geworden und welchen Platz nimmt sie im Leben und Werk ihres Vaters ein?
Nach der intensiven Auseinandersetzung mit Sigmund Freuds Leben und Denken, hat sich Anna wie eine Spielfilmheldin geradezu aufgedrängt. Ich brauche immer die Fiktion, um eine Geschichte zu bauen. Anna hat in Freuds letzter Lebensphase eine zentrale Rolle eingenommen. Ich habe dieses Projekt jahrelang in mir getragen. Ich wollte einen Film mit Freud machen, und wenn man einen Film mit Freud macht, heißt es auch, einen Film mit Anna zu machen. Ich wollte über die Korrespondenzen Freuds Stimme hörbar machen und so die Verbindung zwischen dem Menschen und dem Denker herstellen, der die Ideen seiner Zeit revolutioniert hat. Als Mann der Interpretation (im beinahe talmudischen Sinn), stellt er sich stets selbst in Frage. Durch den Fokus auf Freuds Privatleben – alles steht in seinen Briefen, wenn man sie sorgfältig liest – erzählt der Film sein Leben und die Entwicklung seines Denkens und macht auch den Kontext sichtbar, in dem dieses entstanden ist. Er erforscht das Verhältnis zu seinem Vater, zur komplexen Figur Moses und da ist die schöne und intensive Beziehung zu seiner Tochter Anna, die zur Nachfolgerin und zukünftigen Hüterin des Tempels bestimmt war.
Freuds Judentum spielt in Ihrem Film eine ebenso große Rolle wie die Psychoanalyse selbst, warum?
Freuds atheistisches Judentum bildet das Grundgerüst des Films. Von Kindheit an wird er von seinem jüdischen Erbe beeinflusst. Die Interpretation von heiligen Texten stellt eine erste Übung dar, durch die sich seine spätere analytische Praxis festigen wird. Freud ist durch und durch Jude, aber nicht im religiösen, sondern im atheistisch intellektuellen Sinne, es ist ein jüdischer Atheismus, der den Ideen der Aufklärung nahesteht. Von seiner Kindheit in Armut bis hin zum Aufstieg des Nationalsozialismus hat Freud ohne Unterlass sein Judentum hinterfragt. Der deutsche Titel hätte „Ein ganz gottloser Jude“ lauten können, auf Französisch „Complètement sans dieu et complètement juif“. Ich mochte diesen Titel, den ich sehr zutreffend fand. Es ist eine Formulierung, die er ironisch in einem umgangssprachlichen Österreichisch in einem Brief an den evangelischen Pfarrer Oskar Pfister verwendet.
Wien um die Jahrhundertwende als Schmelztiegel der europäischen Kulturen entwickelte sich zeitgleich mit Freuds innovativen Ideen. Ebenso wie das Wien der Zwischenkriegszeit mit seinen Spannungen und Bürgerkriegen. Wie sind Sie mit den Archivbildern umgegangen, die dieses besondere Klima vermitteln?
Mein Fokus lag bewusst nicht auf dem Wien der Jahrhundertwende im Kontext der Kunst, da mir dieser Blickwinkel im Bezug auf Freud wie eine fremde Fiktion erschien. Freud hat sich nicht sehr für die Kunst und die Avantgarde seiner Zeit interessiert. Mein Film stützt sich auf Archivbilder und von mir gedrehte Aufnahmen von Orten, die Freud möglicherweise gesehen und aufgesucht hat. Ich habe alle Filme oder Fotografien, die nicht seinerzeit entstanden sind, ausgeschlossen. Mein Film ist in seiner Struktur klassisch und linear (von seiner Geburt 1856 bis zu seinem Tod 1939), aber gewagt im formellen Ansatz: er besteht nur aus Archivbildern und Material, das ich selbst mit meiner Super-8 Kamera gefilmt habe und wie Archivmaterial behandle. Es gibt keine Interviews mit Freud-ExpertInnen. Der Film besteht aus gelesenen Korrespondenzen, die von Freud selbst verfasst wurden oder die er erhalten hat. Der Zuschauer ist frei, diese Briefe zu interpretieren und Assoziationen zwischen Erinnerungen aus der Kindheit und Anekdoten aus seinem Erwachsenem-Leben herzustellen. Ich habe einen konsequent Freud’schen Film machen wollen, das heißt, einen Film der durch freie Assoziationen zwischen Bildern und Briefen funktioniert. Es gibt abstraktes Archivmaterial, das metaphorisch funktioniert, Ausschnitte aus Korrespondenzen zwischen Freud und seinen Freunden und Texte, die die Grundlage der Psychoanalyse bilden. Ich habe Freud, den Denker in den Vordergrund gestellt, indem ich die Psychoanalyse ausgespart habe.
Die Frage nach Heimat scheint Freud als Mensch aber auch in seinem Werk beschäftigt zu haben. Wie sind Sie an dieses Thema herangegangen?
Für Freud gibt es keinen Begriff „Heimat“. Seine einzige Heimat ist sein Denken: kosmopolitisch, atheistisch, frei. Freud zog die italienischen Alpen den österreichischen vor. An Wien war ihm nicht besonders gelegen, für Italien hingegen empfand er eine wahre Neigung. Im Grunde scheint mir das aber eher nebensächlich.
Sie haben dokumentarische Porträts (Saint-Laurent, Bardot, Weil, Kadaré...), aber auch Dokumentarfilme gedreht, die eher essayistisch oder poetisch (Mon Amour) waren, oder sich einem Ort widmen (Bania). Wie ist es Ihnen gelungen, zu dieser inhaltlichen wie formalen Vielfalt zu kommen und dennoch stets ein sehr persönliches Werk zu schaffen?
Als Jugendlicher wollte ich Theater-, Opernregisseur und Fotograf werden, aber auch Filme mit bekannten Schauspielerinnen drehen. Und ich habe sehr gerne gelesen. Ich hatte viel im Kopf und wusste noch nicht, wie ich mich auf ein Genre konzentrieren konnte. Als ich meinen ersten Film, Yves-Saint Laurant, 5 Avenue Marceau 75116 Paris gedreht hatte, hat sich das Dokumentargenre als hybride und freie Ausdrucksform bei mir durchgesetzt. Ich habe Yves Saint-Laurent wie einen Filmschauspieler gefilmt. Einige Monate später fuhr ich nach Russland, um die Badeszene von Bania zu drehen. Ich wurde da zum Fotografen. Schon als Jugendlicher hat mich diese Art von Szenerie fasziniert, sie ähnelt der französischen Malerei des 19. Jahrhunderts, ich denke zum Beispiel an La Femme au bain. Ich filme Männer aller Altersstufen nackt, während sie sich waschen und einen geselligen Moment miteinander verbringen, etwas, das Teil der russischen Kultur ist. Die Dokumentarform ist für mich ein wundervoller Raum, in dem ich das Leben von Leuten erzählen kann, die ich sonst nie getroffen hätte. Sie werden, durch mein Filmen und Erzählen zu echten fiktionalen Figuren. Ich suche immer nach einem fiktionalen Zugang, um meinen Filmen eine Form zu geben, vor allem dann, wenn das Thema im Bereich des Dokumentarischen liegt. Ich bin ein Dokumentarfilmemacher mangels Alternative. Zwei Elemente haben mich zum Dokumentarfilm geführt: das Bild und seine Erzählung, seine Dekonstruktion, seine Verschiebung und Neuschöpfung einer freien Narration. Ich brauche immer die Fiktion in meinen Dokumentarfilmen. Als Filmemacher bin ich gespalten zwischen Erzählung, Geschichte und Fiktion.
Meine Filme ebenso wie meine Bücher sind oft zu Publikumserfolgen geworden und das ist wichtig für mich. Wenn man meine Filme sieht, entsteht eine Irritation ähnlich wie bei fiktiven Geschichten, obwohl ich nie die historische Authentizität außer Acht lasse. Ich habe das Leben sehr berühmter und ikonischer Persönlichkeiten, wie Yves Saint-Laurent, Brigitte Bardot (Brigitte Bardor, La Méprise) oder Simone Veil erzählt, ohne einen BiopicFilm daraus zu machen. Ich habe eine intime Form des Films erfunden, die das narzisstische Ich ausschließt und dem Ich des Filmemachers Platz lässt, sodass man etwas zu sehen und zu hören bekommt, was andere für unwichtig halten könnten.
Ich mag keine Frontalität und keinen Realismus, trotzdem handeln meine Filme von Leben und vom Kino. Ich filme auch persönliche Geschichten (La Vie Allieurs wurde in den Pariser Banlieues gedreht, Mon Amour, das von Arte Cinéma koproduziert wurde, wird im Winter 2020 in Frankreich ins Kino kommen und handelt von der Liebe im heutigen Russland und Sibirien). Mir ist es immer wichtig, mich aufs wirkliche Leben zu stützen, um dem obszönen Naturalismus zu entkommen, der den Dokumentarfilm zu oft verseucht. Ich höre gerne Fiktionen, nehme sie auf, um dem sozialen Determinismus zu entkommen, was nicht heißen soll, dass ich sozialen Lebensbedingungen und dem politischen Engagement keinen Respekt zolle.
Ich filme die gesellschaftliche Misere in Russland oder in den Pariser Banlieues mit derselben Methode, mit der ich Yves Saint-Laurent oder das Schicksal einer Heldin wie Brigitte Bardot einfange. Mit meinem Film möchte ich Freud als Denker in den Vordergrund rücken und seine Beziehung zu seinem Judentum betrachten, die Psychoanalyse ausklammern und gleichzeitig ein Werk schaffen, das in seinem Wesen einer Freud‘schen Therapiestunde gleicht.