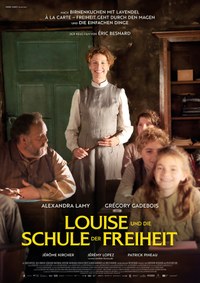Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

Radikal staatstragend
In Thüringen wird sichtbar, wie die Demokratie bröckelt. Dass ausgerechnet ein Linker sie zu retten versucht, ist weniger absurd, als mancher denken mag

1990: Ritter der Tafelrunde
In der DDR wird Hans Modrows Große Koalition zur „Regierung der nationalen Verantwortung“. Acht Vertreter der Opposition ziehen vom Runden auch an den Kabinettstisch

Wie der Dritte Weg so kurz geriet
Warum ging es nach dem Mauerfall nur noch um die Wiedervereinigung? Die frühe Opposition hatte ganz andere Ideen

Hufeisen im Hirn
Linke und Nazis sind quasi dasselbe, und man selbst hat nichts mit denen zu tun – über eine Lebenslüge der Union

German Angst vor dem Aufstehen
Warum ist das Sammlungsprojekt von Sahra Wagenknecht und anderen gescheitert? Ein Psychoanalytiker und Mitglied der ersten Stunde auf der Suche nach den tieferen Gründen

Der SED-Politiker Wolfgang Berghofer im November 1989: „Auch wir sind das Volk“
Wolfgang Berghofer spricht im Herbst 1989 als erster SED-Politiker mit der Oppostion. Der „Sonntag“ befragt ihn für die Ausgabe vom 26. November 1989

„Einmal frei Luft geholt“
Bärbel Bohley wollte nicht in den Westen, sondern die DDR verändern

Total verschuldet?
Die DDR war Ende 1989 nicht bankrott, wie das der „Schürer-Bericht“ seinerzeit suggerierte

Der Genosse mit dem Punk
Inhaltlich ist die Linkspartei für die kommende Landtagswahl gut aufgestellt. Nur die Wähler gehen ihr aus

Alte Narben
Geht der Politiker der Linken als Anhänger der friedlichen Revolution von 1989 durch?

1949: Weimar als Vorbild
Die DDR-Verfassung bekennt sich zum Schutz von Eigentum. Damit wird Privatbetrieben Rechtssicherheit zuteil und zugleich eine gesamtdeutsche Perspektive gewahrt

1989: Elend der Demokratie
Die DDR-Führung will bei Kommunalwahlen Legitimation tanken und bewirkt durch geschönte Resultate das Gegenteil. So beginnt der Wendeherbst bereits im Frühjahr

1949: Deutsche Spaltung
Das Grundgesetz wird eingeführt – und mit ihm ein deutscher Separatstaat. Das Projekt ist ein Kind des Kalten Krieges

Quellen fehlen
War die DDR von Anfang an als Diktatur geplant? Andreas Petersen hat keine Beweise

Vom Doktorvater
Unser Autor ist voll des Lobes für Gerd Dietrichs dreibändige „Kulturgeschichte der DDR“

Sächsischer Kummerkasten
Petra Köpping ist Integrationsministerin im Freistaat und arbeitet vor allem mit der einheimischen Bevölkerung

Sächsische Amnesie
Im Zschopautal steht ein ehemaliges KZ. Eine Initiative will gedenken – und stößt auf Unwillen

1958: Großer Bruder
Der sowjetische Parteichef Chruschtschow wird Entwicklungshelfer der DDR-Wirtschaft und billigt Reformen, mit denen Walter Ulbricht die Zentralisierung überwinden will

1978: Friede den Altären
Bischof Schönherr trifft Erich Honecker, um Spannungen zwischen der evangelischen Kirche und dem Staat zu mindern und ein Verhältnis strikter Distanz auszuhandeln

1977: Neue Wurstwirtschaft
Mit mehr Exquisit- und Delikat-Läden wird in der DDR nicht nur Kaufkraft abgeschöpft. Hochpreisiger Konsum hilft auch, die hohen Devisenschulden einzudämmen

Er ich wieder da
Schaler Schelm: „Willkommen bei den Honeckers“ und „Vorwärts immer!“ machen Jux mit dem Ex-Staatschef

1962: Der Rum-Exit droht
Der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe steht vor dem Zerfall: Rumänien sieht sich benachteiligt – und kokettiert mit dem Austritt aus der sozialistischen Gemeinschaft

Die Farce um Wolf Biermann
Der Sänger wurde wieder ausgesperrt. Von einer Theaterfeier. Und wie 1976 regt sich der Protest. Aber die Motive sind andere

1976: „Bruder Brüsewitz“
Die Selbstverbrennung eines Pfarrers und die Reaktion evangelischer Bischöfe belasten in der DDR das Klima zwischen Staat und Kirche. Von Konterrevolution ist die Rede